Forschen an der THD
Innovativ & Lebendig
Der Technologie Campus Freyung (TCF) ist eine Forschungseinrichtung der THD - Technische Hochschule Deggendorf. Durch anwendungsorientierte Forschung entstehen hier marktfähige optimierte Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Der TCF kooperiert mit Partnern aus der Wirtschaft und entwickelt für Unternehmen.
Über den Campus Freyung

Die Vision hinter der Regionalisierung der Hochschule ist der Aufbau der Region Bayerischer Wald hin zu einer Technologieregion. Dabei steht die enge Zusammenarbeit von Industrie und Hochschule im Vordergrund.
Das Konzept „Technologieregion Bayerischer Wald – Technologietransferzentren der Hochschule“ gründet sich auf die Unterstützung des Wissenschaftsministeriums und der Partnerkommunen und wurde 2010 mit dem Bayerischen Gründerpreis ausgezeichnet.
- Forschungs- und Entwicklungskooperationen - Hochschule-Wirtschaft
- Auftragsforschung und -entwicklung für Unternehmen, insbesondere auch KMU
- Forschung im Rahmen von öffentlichen Förderprogrammen
- Entwicklungen von innovativen Technologien, Produkten und Ideen
- Einzelprojekt oder Zusammenarbeit in Clustern
- Untersuchungen im Rahmen von Hochschulprojekten
- Innovationsworkshops und Innovationsmanagement
- Technologiescouting
- Fördermittelscreening
- Nutzung der Campus-Labore
- Patent- und Erfinderberatung
- Gründungsberatung für technologieorientierte Unternehmen
Tätigkeitsfelder
Die Arbeitsgruppe Bionik besitzt zwei Forschungsschwerpunkte: Bionik als Methode für Produktoptimierung und Innovation und Funktionelle Oberflächen.
Ansprechperson: Prof. Dr. Martin Aust (Leiter Arbeitsgruppe Bionik)
Bionik & Innovation
- Forschung: Analyse und Weiterentwicklung des Bionik-Prozesses
- Bionik inspiriert Unternehmen: Erfolgreicher Wissenstransfers aus der Forschung in die Anwendung
- Beratung über den Einsatz von Bionik in Unternehmen
- Bionik-Innovationsworkshops, auch für KMU
- Lehre
- Akademische Weiterbildung: Sommerakademie Bionik
- Netzwerk: Cluster Bayonik
- Nachwuchsförderung: Zusammenarbeit mit Schulen
- Lehrerfortbildungen
Unsere Kooperationsparter:
- Business Upper Austria - Wirtschaftsagentur Oberösterreich
- Land Oberösterreich
- ITG - Innovationsservice für Salzburg
- Land Salzburg
- Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V.
Abgeschlossene Projekte:
- Cluster Bayonik - Bionik Netz Bayern, HTO-Förderung (2009-2012)
- Bayerisch-Französische Zusammenarbeit "Bionik und Innovation", Kooperationspartner, Centre Francilien de l'Innovation, Paris, BFHZ (2013)
- Funktionelle Oberflächen durch Selbstorganisation (FOSorg), Kooperationspartner: Parat GmbH & Co. KG, Bayerisches Programm Neue Werkstoffe, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, (2013-2016)
- ImB - Innovativ mit Bionik!, Kooperationspartner: ITG - Innovationsservice für Salzburg, Clusterland Oberösterreich GmbH, Interreg Bayern-Österreich, EFRE (2013-2015)
- Be Bio-inspired - Berufschancen durch Bionik, Programm: Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen, Bayerisches Staastministerium für Wissenschaft, Bildung und Kunst (2013-2014)
- BIG - Bio-inspirierte Generation, Internationale Zusammenarbeit in Bildung Forschung mit Partnern aus Mittel- und Südosteuropa, BMBF (2016-2017)
- ILBiTZ - Innovative Lösungen durch Bionik im transnationalen Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft, Interreg Österreich-Bayern, EFRE (2016-2019)
Funktionelle Oberflächen - Technologieforschung:
- Funktionalitäten von Oberflächen: Leichtreinigung, Selbstreinigung, Kratzfestigkeit, Antibakterielle Oberflächen, Antibeschlagschichten (antifogging) und Korrosionsschutz
- dahingehend Modifizierung von Materialzusammensetzungen (z.B. bei Kunststoffprodukten)
- Produktion von funktionalen Lacken in kleinerem Umfang
Funktionelle Oberflächen - Dienstleistung:
- Oberflächenanalyse: Infrarot-Spektroskopie (FTIR), Kontaktwinkelmessung, REM und Lichtmikroskopie
- Materialanalyse: Tomografie, Mechanische Prüfungen und Thermische Prüfungen (z.B. DSC)
Kooperationen:
- innerhalb des Netzwerks Cluster Bayonik
- Vernetzung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene
- Zusammenarbeit im Bereich bionischer Leichtbau mit der FH Landshut
- Zusammenarbeit im Bereich Nachwachsende Rohstoffe mit dem Bio-Campus Straubing
Leistungsspektrum:
- Software Defined Radio – Signal und Datenanalyse
- Virtualisierung und hyperkonvergente Infrastruktur

- Softwareintensive Systeme
- IoT – Eingebettete Sensoren und Systeme
- Künstliche Intelligenz und High Performance Computing
- Intelligente Mobilität
- UAS und Fernerkundung
- Intelligente Energiesysteme
Ausstattung:

- Hochfrequenz-Messplatz
- EMV-Tablet für Voruntersuchungen
- Thermografiemessplatz
- Temperaturschrank
- Software Defined Radio (SDR)
- 3D-Druck (FDM)
- SMD-Bestückung
Abgeschlossene Projekte:
- iGATES - Intelligentes Gateway zur Teilnetz-Simulation der neuen Bordnetz-Architektur im Automobil, gefördert als ZIM-Kooperationsprojekt: b-plus GmbH (2013-2015)
- HiS-Switch - Entwicklung eines Onboard-Switches für Automotive Ethernet-Netzwerke, gefördert als ZIM-Kooperationsprojekt: b-plus GmbH (2014-2016)
- FraLa/iLEM - Entwicklung eines Frameworks für Ladestationen, gefördert als luK-Projekt (2013-2015)
- IntLaTech (Smart Charging Community) - Entwicklung eines Energiemanagementsystems für Ortsnetze. Aufbau von Sensorknoten und einer Testumgebung, gefördert als ZIM-Kooperationsprojekt, (2013-2016)
- RFID-Tag-Localisation
- Thermografieuntersuchungen an Platinen - Erkennung von Hotspots und Optimierung der Entwärmung (2015-2016)
Zusammenarbeit:
- Förderung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene durch Einbindung in Forschungsprojekte
- Unterstützung bei der Antragerstellung
- Auftragsforschung
Ansprechpersonen: Alexander Faschingbauer (Teamleiter) & Rainer Pöschl (Teamleiter)
Die Geoinformatik ist die Wissenschaft von der elektronischen Verarbeitung geographisch-raumbezogener Information. Als Fachinformatik der Geographie und Vermessungskunde stellt sie raumbezogene Information als Geodaten bereit. Diese Daten sind die Grundlage für Geoinformationssysteme (GIS), die vielfältig Anwendung finden. Durch Mobile Navigationsgeräte, Routenplaner, Internetkartendienste und Globensoftware wie Google Earth sind Geoinformationssysteme und die Geoinformatik bereits fester Bestandteil unseres Lebens.
Leistungsspektrum:
Angewandte Energieforschung & Elektromobilität
Eine zukunftsorientierte und klimafreundliche Gestaltung der Energieversorgung zählt zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Eckpunkte in diesem Zusammenhang sind die Steigerung der Energieeffizienz z.B. Gebäudeautomation, der Ausbau und die sinnvolle, zukünftige Nutzung von erneuerbaren Energien und der sparsame Umgang mit Energie. Auch die lokale und kommunale Ebene kann von dieser Transformation der Energiesysteme profitieren. Eine nachhaltige Entwicklung hat hohen Stellenwert. Der Einsatz erneuerbarer Energien sowie eine dezentrale Energieversorgung mit hoher Wertschöpfung und großer Akzeptanz vor Ort werden als erstrebenswert angesehen. Wir arbeiten an der Verknüpfung von effektiv gesteuertem Energieverbrauch und intelligent geregelter Energieerzeugung, um damit eine kreative, ganzheitliche Versorgungsmöglichkeit für Mobilität und öffentlichen Raum zu finden.
Leistungsspektrum und Kompetenzen:
- Elektromobilitätskonzepte
- Energienutzungspläne und regionale Energiekonzepte
- Standortanalysen für Erneuerbare Energien
- Nahwärmekonzepte und Solarkataster
- Verbrauchs- und Erzeugungsmonitoring
- Versorgungskonzepte durch virtuelle Kraftwerke
- Gebäudeautomation (eu.bac Zertifizierung)
- Informations- und Schulungsveranstaltungen zum Thema Energiecoaching und Geoinformationssysteme
Räumliche & zeitliche Modellierung
Leistungsspektrum und Kompetenzen:
- Analyse und Validierung von räumlich und zeitlich hochaufgelösten Wetterdaten
- Zeitlich hochaufgelöste Solarkataster
- Planung von dezentralen erneuerbaren Energiesystemen
Umwelt, Raumplanung, Information & Gesellschaft
Die Arbeitsgruppe URIG befasst sich in erster Linie mit Raumplanungsverfahren, welche digitale Medien und Geographische Informationssysteme zusammenbringen. Dabei kommen fortschrittliche Formen der Informationsgenerierung wie z.B. Crowdsourcing oder die Visualisierung mittels Augmented Reality zum Einsatz. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich in verschiedenen Projekten damit, technische Innovationen im Bereich der PPGIS (Public Participation Geographic Information Systems) in Planungsprozesse zu integrieren. Damit können raumrelevante Fragestellungen von Städten, Gemeinden und Unternehmen genauer untersucht und deren Planungsprozesse optimiert werden. Die Arbeitsgruppe greift damit die Lücke zwischen technischen Möglichkeiten und neuen Verfahren einerseits und Stadt-, Raumplanung und Bürgerbeteiligung andererseits auf, um gesellschaftliche Konflikte bei unterschiedlichen Projekten zu lösen.
Leistungsspektrum und Kompetenzen:
- Raumplanung
- Bürgerbeteiligung und Partizipation
- Standortanalysen
- Räumliche Modellberechnungen
- Projektvisualisierung mittels Augmented Reality
- Qualitative und quantitative Befragungen mit Hilfe neuer digitaler Medien
- Ideenakquirierung mittels Crowdsourcing
UAV & Fernerkundung
Praxistaugliche unbemannte Kleinflugzeuge (unmanned aerial vehicle, UAV) eignen sich im Bereich der Geodaten-Anwendung vor allem für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft. Bei der GPS-gestützten Präzisionslandwirtschaft geht es beispielsweise um die Berücksichtigung kleinflächig auftretender Unterschiede im Feld (teilflächenspezifische Variabilität), wie z.B. die Berücksichtigung der Biomasseverteilung oder die Variabilität der Ernährungs- und Schädlingssituation. Die für diesen Zweck einsetzbaren UAVs besitzen geeignete Fernerkundungssensoren, bspw. im Bereich Nah-Infrarot, Thermal-Infrarot (Wärmebild), Multispektral oder Hyperspektral. Zeitnah erfasste UAV-gestützte Fernerkundungsdaten ermöglichen eine flächenhafte Erfassung der Nährstoffsituation in den Pflanzen und damit ein exakt angepasstes, GPS-gestütztes Ausbringen von Dünger. Das Einsparpotential ist dabei erheblich, wobei das Verfahren gleichzeitig umweltschonend ist, weil auch nur kleinflächige Überdüngungen vermieden werden können.
Leistungsspektrum und Kompetenzen:
- kundenindividuelle Anpassung von UAV
- anwendungsorientierte Erstellung von UAV
- projektspezifische Ausstattung von UAV
- Nutzung verschiedener Flugführungssysteme (Autopilot, videogestützt)
- Integration verschiedener Fernerkundungssensoren
Ansprechpersonen: Prof. Dr. Wolfgang Dorner & Prof. Dr. Roland Zink
Die steigende Nachfrage nach Smartphones erfordert stabile und innovative Hard- und Software-Lösungen. App-basiertes Auslesen von Fahrzeugdaten, Steuerung von Fertigungsmaschinen via Smartphone oder Navigation in Fabrikgebäuden und Messehallen sind dabei nur einige der Anwendungsmöglichkeiten und lassen dabei einen Schluss auf das weitreichende Potenzial der Technologie zu.
Die Arbeitsgruppe Mobile Systems und Software Engineering konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung von Applikationen für Android, iOS und Windows Phone. Darüber hinaus werden plattformübergreifende Anwendungsprogramme mit maximaler Betriebssystem-Kompatibilität entwickelt. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Homogenität im Hinblick auf Design sowie Usability. Durch einen umfangreichen Bestand von Testgeräten, der ständig um die Marktneuheiten erweitert wird, können erstellte Applikationen auf ein breites Spektrum von Geräten abgestimmt werden.
Abgeschlossene Projekte:
- MobileTechTeach (Mobile Computing, Android Anwendung): Mobile multimediale Hilfesysteme für technische Anwendungen, Kooperationspartner: Universität Passau, ESF-Förderung (2012-1014)
- Virtuelles Kraftwerk: Anwendung zur Simulation eines Kraftwerk-Portfolios zur Bedarfsdeckung einer Elektrofahrzeugflotte, Kooperationspartner: HM-Pv (2013-2015)
- INSAG - Innovative Nutzung von Satellitennavigation und Geländeinformationen, Kooperationspartner: DLR, RUAG, 3D RealityMaps, TU München, Bergwacht Bayern, Förderung: Bayerisches Raumfahrtförderprogramm (2013-2014)
- E-Wald Ladetechnik - Entwicklung einer webbasierten HMI und eines Kommunikationsmoduls für eine DC-Ladesäule (2013-2016)
- MicroUAV - Entwicklung einer Postprozessing-Software für ein Multichannel Messsystem eines MicroUAVs, gefördert als ZIM-Kooperationsprojekt, Partner: Optris GmbH (2014-2016)
Zusammenarbeit:
- Förderung auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene durch Einbindung in Forschungsprojekte
- Unterstützung bei der Antragerstellung
- Auftragsforschung
Ansprechpersonen: Alexander Faschingbauer (Teamleiter) & Rainer Pöschl (Teamleiter)
Projekte
Partner
Der Technologie Campus Freyung arbeitet regional mit Partnern aus Wirtschaft und Bildung zusammen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationspartner in unseren Forschungsprojekten der einzelnen Arbeitsgruppen.
Förderverein

Seit seiner Gründung am 22.04.2009 unterstützt der Förderverein Technologie Campus Freyung e.V. die Öffentlichkeitsarbeit, den kontinuierlichen Aufbau des TCF, die Beziehungen zwischen Unternehmen und der Hochschule, die Auszeichnung hervorragender Absolventinnen und Absolventen, sowie diverse Veranstaltungen.
Zahlreiche Projekte konnten dank der Unterstützung des Fördervereins bereits am Technologie Campus Freyung zur Stärkung von Wissenschaft, Forschung und Lehre durchgeführt werden. Unter anderem: Summerschool Geoinformatik für Schüler, Bionik-Projekttage für Schüler, Hochschule Hier und Jetzt - Vortragsreihe, Bionik-Vortragsreihe, Sommerakademie Bionik für Studierende und die Finanzierung von Laborausstattung und Kleingeräten.
Aktuelles

Ländliche Gemeinden in der gesamten EU stehen vor besonderen Herausforderungen was Nachhaltigkeit angeht. Um diese zu bewältigen und Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, müssen diese gelöst werden. Das europäische Projekt STORCITO mit Beteiligung der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Das Projektkonsortium traf sich dafür nun von 18. bis 20. November in Spanien.
Grundlage für Fallstudie gelegt
Unter Leitung der Universidad de Vigo in Nordspanien kamen elf Partner aus fünf europäischen Ländern zum ersten Präsenzmeeting des Projekts STORCITO in Allaríz in Spanien zusammen. Rund dreißig Personen aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Norwegen und Griechenland hatten es sich in diesen Tagen zum Ziel gemacht, die Grundlagen für die Fallstudien des Projektes zu legen und mit der Arbeit an ebendiesen zu beginnen. Einen Teil des Treffens stellte der von den Mitarbeitern der THD geleitete Workshop „Wildfire Prevention Toolbox“, dar. Die Wissenschaftler um Prof. Dr. Javier Valdes von der THD entwickeln hierbei ein Tool, welches anhand von Wetter- und Geodaten das regionale Waldbrandrisiko präzise prognostizieren kann.
Interessensgruppen aus Region einbezogen
Das Projekt STORCITO zielt darauf ab, die Gesellschaft einzubeziehen und so den bestmöglichsten Effekt für die Menschen vor Ort zu erreichen. Deshalb waren diverse zukünftige Interessensgruppen aus der Region zum Projekttreffen eingeladen worden, darunter Vertreter aus Politik, Brandbekämpfung und der Industrie, aber auch betroffene Einwohner. Deren Expertise und Bedürfnisse leisten einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Projektes.
Über das Projekt
Das von Horizon Europe geförderte Projekt hat es sich zum Ziel gemacht, ländliche Gebiete auf dem Weg in eine inklusive und klimaneutrale Zukunft zu unterstützen. Das beinhaltet einen besseren Schutz vor Waldbränden, die Versorgung mit sauberer Energie, welche auch die Thematik der CO2-Abscheidung und – Speicherung einschließt und eine bessere Vernetzung durch umweltfreundliche Verkehrsmittel. Geleitet wird das Projekt vom Campus Ourense der Universidad de Vigo.

Zwischen Strandbar und Schiffsanleger parkte der knallrote Oldtimer-Doppeldeckerbus der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), daneben die Experimentierstationen des MINT-Teams, drumherum zahlreiche Liegestühle zum gemütlichen Verweilen: Zum ersten Mal war die THD mit einem großen Stand beim Donaufest dabei. Das täglich wechselnde Programm bot jede Menge Technik und Wissenschaft zum Anfassen. An allen vier Tagen mit an Bord: Das MINT-Team der THD. Mit spannenden Alltagsexperimenten und verschiedenen Technik-Challenges fanden Kinder spielerisch Zugang zum Programmieren oder konnten physikalische Phänomene erkunden. Natürlich wurden während der vier Eventtage auch allgemeine Fragen rund ums Studieren an der THD beantwortet und Maskottchen Deggster durfte auch nicht fehlen.
„Beim Donaufest konnten wir uns als Hochschule mit unserem breiten Themenspektrum in Forschung und Lehre ideal präsentieren“, sagt Prof. Dr. Veronika Fetzer, die die Teilnahme initiiert hatte. Groß und Klein konnten bei dem Event Wissenschaft mit allen Sinnen wahrnehmen, beim Experimentieren selbst Hand anlegen oder Forschenden Löcher in den Bauch fragen. „Auf dieser spannenden Reise durch die Welt der Technik an der THD ist es uns gelungen, viele Gäste möglichst nachhaltig für uns als Hochschule und unsere Arbeit in der Forschung zu begeistern“, blickt die Vizepräsidentin Third Mission auf die erfolgreiche Teilnahme am Donaufest zurück.
Der Donnerstag widmete sich den Drohnen. Es wurde erläutert, wie und warum Drohnen zur Fernerkundung eingesetzt werden. So können beispielsweise die Waldbrandgefahr aus der Luft beobachtet oder Gebiete nach verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten gescannt werden. Auch werden Drohnen mit Thermokameras zur Vermisstensuche eingesetzt. Daneben konnten die Gäste anhand eines 3D-gedruckten Geländemodells des Deggendorfer Umlands bis Regen und Sankt Englmar erfahren, wie sich verschiedene Untergründe bei Starkregenereignissen verhalten. Dafür wurde die Oberfläche des Modells mit verschieden saugstarken Materialien wie Schwämmen oder Pappe präpariert, um es anschließend aus einer Gießkanne darüber regnen zu lassen.
Am nächsten Tag drehte sich alles rund um Exoskelette. Interessierte Besucherinnen und Besucher konnten ein passives Exoskelett anprobieren und am eigenen Leib erfahren, wie damit schwere körperliche Arbeiten erleichtert werden können. Außerdem wurde der Prototyp eines aktiven Exoskeletts vorgestellt, der mit seinen speziellen Motoren und ausgeklügelter Steuerung nicht nur im Arbeitsalltag Anwendung finden soll, sondern auch als technisches Unterstützungssystem bei Rehamaßnahmen zum Einsatz kommen kann.
Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit durften die Gäste am Samstag verschiedene Techniken und Ansätze ressourceneffizienter Produktentwicklung im Maschinenbau kennenlernen. Circular Engineering verfolgt dabei ganzheitliche Ansätze, um einerseits Rohstoffe achtsam einzusetzen und zu recyceln und andererseits Maschinen und Geräte so zu fertigen, dass sie gut repariert werden können. In einem Quiz stellten die Besucherinnen und Besucher ihr Allgemeinwissen zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen unter Beweis und durften anschließend einen 3D-gedruckten Roboter oder einen handbetriebenen Ventilator bauen.
Den thematischen Abschluss machte am Sonntag schließlich das große Themengebiet Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). Mit einer VR- und einer AR-Brille konnten die Gäste die Technik direkt selbst ausprobieren und erleben, wie sie beispielsweise zur Fernwartung oder für Schulungszwecke im Berufsalltag eingesetzt werden kann. Besonders begeistern konnte dabei der Drohnenflugsimulator, bei dem in einem Windpark ein Feuer gelöscht werden musste.
Neben dem Doppeldeckerbus bot die THD außerdem in Vorträgen Einblicke in die moderne Gesundheitsversorgung. Dabei beleuchteten die Expertinnen und Experten neben der Digitalisierung die Einflüsse von Bewegung und Gesundheitskompetenzen auf eine bessere Versorgung sowie einfache lebensrettende Maßnahmen in Prävention und Notfallversorgung. Für Jubelmomente sorgten die THD-Teams am Sonntag bei der Ruderregatta. In allen drei Klassen – im Damen-, Herren- und Mixed-Achter – setzten sich die THD-Sportlerinnen und Sportler souverän gegen die der Universität Passau durch.

Am 19. Mai fand am Bezirksklinikum Mainkofen im Rahmen des EU-geförderten Projekts RENvolveIT (Regional Energy Networking – cross-sectional involvement through a modular interactive toolbox) gemeinsam mit der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) und den Regionalwerken ein Workshop statt. Das Ziel dieser und weiterer internationaler Veranstaltungen im gleichen Monat, war die Einbindung verschiedener Akteure in die Entwicklung einer Software-Toolbox, die zukünftig Energiegemeinschaften in ganz Europa unterstützen soll.
„Eine derartige, den gesamten Lebenszyklus von Energiegemeinschaften abdeckende Lösung, fehlt bislang auf dem europäischen Markt“, erklärte dazu Prof. Dr. Javier Valdes vom Technologie Campus Freyung der TH Deggendorf. Die Regionalwerke, Vorreiter bei der Entwicklung von Energiegemeinschaften auf kommunaler Ebene in Bayern, teilten im Workshop ihre umfangreiche Erfahrung und gaben strategische Einblicke, wie beispielsweise das Bezirksklinikum Mainkofen an Energiegemeinschaften teilnehmen und am Energiemarkt mitwirken könnte. Es wurde hervorgehoben, wie neue Marktregulierungen auch für das Bezirksklinikum Vorteile bringen und weitere Kommunen im Landkreis Deggendorf einbinden könnten.
Im Mittelpunkt des Treffens stand zunächst die Analyse der aktuellen Situation des Bezirksklinikums Mainkofen in Bezug auf die Nutzung erneuerbarer Energien, Gebäudesanierung und digitales Energiemanagement. Alle Erkenntnisse gingen direkt in die Weiterentwicklung der RENvolveIT-Toolbox ein. Mit dem Beispiel Mainkofen soll sichergestellt werden, dass der digitale Werkzeugkasten auch in komplexen Anwendungsumgebungen wie einem Krankenhaus praxisgerecht einsetzbar ist.
„Wir möchten eine Software entwickeln, die neue Energiegemeinschaften bei ihrer Orientierung unterstützt und etablierte bei ihrem Tagesgeschäft begleitet“, sagte Workshop-Leiterin Vladimíra Mašindová, Projektmanagerin bei Frank Bold, einem internationalen Expertenkonsortium. Neben der Optimierung von Energiequellen und deren Zuordnung zu passenden Verbrauchern solle die Software auch eine Art »Ampel« enthalten, die anzeige, wann es günstiger sei, Energie zu verbrauchen oder einzusparen.
Professor Valdes und die Forschungsgruppe Spatial AI der THD passen derzeit ein Simulationswerkzeug an, um effiziente und kostengünstige Energieszenarien speziell für das Bezirksklinikum zu modellieren. Dazu wird ein neues Modul entwickelt, das den Wärmebedarf basierend auf der Gebäudestruktur abschätzt, sowie ein Fernwärmesimulationsmodul, das in das bestehende Stromnetzmodell integriert wird. „Angepasst an die deutsche Gesetzeslage gibt es für Mainkofen drei zentrale Bedürfnisse“, so Valdes: „Ein zuverlässiges Tool zur Erstellung techno-ökonomischer Modelle, einen ein Echtzeitüberblick über die Energieflüsse im System sowie eine einheitliche und verständliche Informationsquelle.“
Projektinformationen
RENvolveIT integriert sechs digitale Werkzeuge zur Unterstützung der Energieplanung und des laufenden Betriebs. Der Co-Design-Prozess stellt sicher, dass die Werkzeuge an die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen angepasst sind – von Krankenhäusern über Kommunen bis hin zu Energiegemeinschaften – und in Pilotprojekten in den Niederlanden, Österreich, Tschechien und Deutschland weiterentwickelt werden. Das Projekt vereint 13 Partner aus vier Ländern und wird durch die CETPartnership im Rahmen der Joint Call 2023 sowie durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont Europa der Europäischen Union (Förderkennzeichen 101069750) kofinanziert. Durch die Verbindung lokaler Einblicke mit internationaler Expertise soll RENvolveIT Energiegemeinschaften befähigen, grenzüberschreitend wirksame Werkzeuge einzusetzen.
Eine Energiegemeinschaft vereint Produzenten und Verbraucher von lokal erzeugtem, erneuerbarem Strom. Mitglieder können Kommunen, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, Landwirte, Unternehmer oder Privatpersonen sein. Gemeinsam bilden sie ein virtuelles Netzwerk zur gemeinschaftlichen Nutzung und Verteilung erneuerbarer Energien.

Die ersten Schritte für eine gelungene länderübergreifende Forschungspartnerschaft sind getan. Mitte Mai trafen sich die beteiligten Projektteilnehmer der Tschechischen Technischen Universität Prag (ČVUT) und der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) erstmals am Campus Freyung. Im Mittelpunkt stand das gemeinsame bayerisch-tschechische Projekt mit dem Titel „Situationswahrnehmung in der Robotik-Telemetrie mittels belastbarer Kommunikationstechnologie“. Ein Thema, das auf den ersten Blick wie aus einem Science-Fiction Roman klingt, jedoch sehr wichtige und konkrete Probleme in der Praxis zu lösen vermag.
Besonders in ländlichen und grenznahen Regionen fehlt es an stabiler zuverlässiger Netzabdeckung. Dies ist für die einzelne Person bestenfalls lästig, doch für moderne Einsatzteams, die mit Drohnen und Robotern arbeiten, die auf Echtzeitdaten angewiesen sind, kann dies schnell zu einem ernsten Problem werden. Heutzutage werden bereits vereinzelt Drohnen und Roboter bei riskanten Rettungseinsätzen oder im Katastrophenschutz eingesetzt. Kommt es jedoch zu einer größeren Naturkatastrophe, wie beispielsweise einem großen Waldbrand, kann die öffentliche Infrastruktur ausfallen, was den Rettungseinsatz mit Hilfe von Drohnen und Robotern behindern kann. Aus diesem Praxisproblem konkretisierte sich das Vorhaben der beiden Hochschulen, „eine flexible Lösung zu entwickeln, die unabhängig vom bestehenden Netz arbeitet“, so Markus Peterhansl beteiligter wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team von Prof. Dr. Wolfgang Dorner (THD) auf Nachfrage der Redaktion.
Gemeinsam mit der Tschechischen Technischen Hochschule will Professor Dorners Team mobile 5G-Netze konzipieren, die genau dort aufgebaut werden können, wo sie gerade gebraucht werden. Zugleich sollten sie so gestaltet sein, dass sie mit den bestehenden öffentlichen Netzen zusammenspielen können. Dies soll maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Das Gute an diesem Projekt ist, dass die mobilen 5G-Netze nicht nur für jene Notfalleinsätze sinnvoll sein können, sondern auch auf andere Bereiche gut übertragen werden können. So können sie beispielsweise unter anderem in der Landwirtschaft, wo Roboter große Felder überwachen, oder im Grenzschutz eingesetzt werden, bei dem mobile Systeme abgelegene Areale beobachten. Im Großen und Ganzen ginge es bei dem Projekt also darum, die Kommunikationswege zwischen Menschen und Maschinen zu verbessern und die Maschinen somit effizienter in menschliche Arbeitsabläufe integrieren zu können.
So nahtlos wie die Mensch-Maschine-Kommunikation eines Tages laufen soll, funktioniert glücklicherweise bereits die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Forschern der TH Deggendorf und der ČVUT Prag. „Jeder Projektpartner bringt eine ganz eigene Expertise mit ein und das ergänzt sich hervorragend“, so Peterhansl. Auf Seiten der ČVUT Prag besitze man das Know-how im Bereich Robotik, insbesondere bei mobilen Robotern mit hochentwickelten Sensorsystemen. Auf der anderen Seite sei man versiert im Aufbau moderner Kommunikationsnetze, vor allem privater 5G-Netze.
Das Projektteam der CTU in Prag, unter der Leitung von Prof. Ph.D Jan Faigl mit den Forschenden Jan Bayer, Jáchym Herynek und Bedřich Himmel, kümmere sich um die Entwicklung und Steuerung der Robotersysteme, während das Projektteam der THD unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Dorner und den Forschenden Markus Peterhansl und Simon Uhrmann den Aufbau der 5G-Infrastruktur vorantreiben. Darüber hinaus wird an der passenden Datenverarbeitung, der Integration alternativer Funktechnologien oder an Algorithmen zur Optimierung der Kommunikation geforscht.
Nach erfolgreicher Vollendung des Projekts am 31. Dezember 2026, erhoffen sich die Forscher ein gemeinsames Paper mit den Erkenntnissen ihres Forschungsprojektes veröffentlichen zu können und die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen THD und ČVUT durch weitere Projekte ausbauen und vertiefen zu können.

Das Kickoff-Treffen am 11. Dezember 2024 in Berlin markiert den Start der Zusammenarbeit der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) und deren Partner im neuen internationalen Projekt RENvolveIT. Dieses steht für „Regional Energy Networking – cross-sectional involvement through a modular interactive toolbox“ und vereint dabei die Expertise aus den vier europäischen Ländern Deutschland, Österreich, Tschechische Republik und Niederlande. Hierbei treten neben Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie Software- und Dienstleistungsunternehmen auch NGOs in einen Austausch, um ein kostenfreies Softwaretool für eine einfachere Realisierung und Administration von Energiegemeinschaften zu entwickeln.
Im Rahmen des Projekts RENvolveIT soll ein Werkzeugkasten aus verschiedenen Modulen erzeugt werden, welcher den Energiegemeinschaften die jeweils individuell benötigten Tools zur Verfügung stellt. Dadurch können zum Beispiel die Planung von Stromverbrauch und -erzeugung erleichtert werden. Unter Leitung von Prof. Dr. Javier Valdes betreut ein Geoinformatik-Team am Forschungsstandort Freyung der THD das Arbeitspaket, das sich auf die Entwicklung der Toolbox konzentriert. Gleichzeitig stellt das Team das sogenannte EnerplanET-Tool zur Verfügung, welches in dem bereits 2024 abgeschlossenen EU-Projekt CrossChargePoint weiterentwickelt wurde. Mit dem Konsortium teilen sie eine kostenlose Online-Version des Tools, welche die Modellierung von Energiesystemen ermöglicht. Das ist sehr nützlich, um den Energieverbrauch von Gebäuden als Ganzes zu ermitteln und kann zudem zur Modellierung von Verteilungsnetzen verwendet werden. „Dieses Projekt ermöglicht es uns, Hand in Hand mit führenden Arbeitsgruppen zu arbeiten. Die Lösung der Herausforderungen auf europäischer Ebene erfordert ein hohes Maß an Koordination zwischen den Akteuren und die Berücksichtigung vieler Besonderheiten der Regionen in gemeinsamen Ansätzen. Dies ist sehr schwierig, aber es ist das Konzept, nach dem wir gesucht haben, als wir EnerplanET ins Leben gerufen haben“ erklärt Prof. Dr. Valdes.
Die größten Herausforderungen, denen das Projekt und seine Partner in den nächsten drei Jahren gegenüberstehen werden, sind zum einen aus allen im Moment existierenden Modulen ein einheitliches System zu erschaffen und zum anderen die vielfältigen Vorgaben und Regelungen der verschiedenen EU-Ländern. Das Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen der CETPartnership von Horizon Europe gefördert, wobei der in Deutschland erforschte Teil des Projekts zusätzlich durch eine Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt wird.

Am Donnerstag, den 08. August kamen die Partner des Projekts 5G in der Nationalparkregion (5GNPR) in Spiegelau zu dem Abschluss eines Teilbereichs des Projekts zusammen, in dem der Aufbau eines automatisierten Bus Shuttles für Touristen getestet wurde. Neben dem Technologie Campus (TC) Freyung, einem Forschungsstandort der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), welcher die Projektleitung inne hat, sind die Unternehmen Schiller Automatisierungstechnik, b-plus technologies, DBRegio und die Gemeinde Spiegelau an diesem Teilbereich beteiligt. Das Pilotprojekt soll wichtige Erkenntnisse über die Effizienz von autonomen Fahrzeugen in abgelegenen und naturbelassenen Gebieten liefern.
Das Projekt 5GNPR wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert und erforscht Anwendungen von 5G für verschiedene Einsatzszenarien in der ländlichen und waldreichen Mittelgebirgsregion rund um den Nationalpark Bayerischer Wald. Diese werden in touristisch geprägten Gemeinden wie Spiegelau getestet. Der Test des Aufbaus eines automatisieren Bus Shuttles deckt dabei die Projektsäule Mobilität und Verkehr ab. Die konkrete Teststrecke des Busses führte dabei vom P+R Parkplatz in Spiegelau zum Parkplatz „Gfäll“. Laut dem Projektkoordinator des TC Freyung, Sebastian Kohler, barg die Streckenbegebenheit hierbei einige Herausforderungen, die im Rahmen des Projekts gemeistert werden mussten. Zahlreiche Sensoren und Kameras, die am Bus angebracht wurden, sammelten und werteten Daten in Echtzeit aus, um eine sichere und präzise Navigation zu ermöglichen.
Die dabei erlangten Ergebnisse können anschließend als Modell für ähnliche Regionen weltweit dienen und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft leisten. „In Deutschland ist der Mangel an Fahrpersonal bereits sehr groß. Das automatisierte und in Zukunft auch das autonome Fahren kann dazu beitragen, diese Lücke künftig zu schließen. Die Erkenntnisse aus dem 5GNPR Projekt werden in neue und auch bereits laufende Projekte mit einfließen, um dem Ziel den ÖPNV durch Automatisierung zu stärken ein Stück näher zu kommen“, so Lars Abeler von DBRegio. Bernhard Pfeffer von b-plus technologies sieht zudem weiterführendes Potential in der im Projekt entstandenen Simulationslösung, welche Strecke, Bus und weitere Verkehrsteilnehmer virtuell abbildet. Damit könnten künftig verschiedene Auslastungsszenarien beleuchtet und das Verkehrs- und Besuchermanagement verbessert werden.

Die Installation von Hochwasser-Pegelsensoren der Firma Spekter in der Gemeinde Spiegelau am Donnerstag, den 25. Juli, markiert einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des Projekts 5G in der Nationalparkregion (5GNPR), welches vom Technologie Campus Freyung (TCF), einem Forschungsstandort der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), betreut wird. Neben der Firma Spekter fungiert auch die Gemeinde Spiegelau als ein wichtiger Projektpartner des TCF. Die Sensoren sollen künftig dabei helfen, präzise Vorhersagen über potenzielle Überflutungen nach Starkregen bereitzustellen.
In dem vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderten Projekt 5GNPR wird erforscht, welche Anwendungsmöglichkeiten von 5G in ländlichen Gebieten bestehen. Im Rahmen des Projekts wird dabei das Potential des Aufbaus einer 5G-Infrastruktur in den vier Kernbereichen Tourismus, Forstwirtschaft, Rettungswesen und Smarte Kommunale Infrastruktur untersucht. Die Implementierung der Regensensoren deckt dabei den Bereich Monitoring, also Überwachung der kommunalen Infrastruktur ab. Die an zwei verschiedenen Stellen installierten Pegelsensoren sollen künftig kontinuierlich Daten über den Wasserstand sammeln und die Echtzeitdaten an eine zentrale Wetterstation im Feuerwehrhaus der Gemeinde Spiegelau senden. Dies geschieht anhand von Radartechnologie, welche die Wasseroberfläche des Flusses Schwarzach millimetergenau erfasst. Die in der Wetterstation gesammelten Daten werden anschließend mithilfe von 5G an die Server des Projektpartners Spekter weitergeleitet. In Kombination mit den vom Deutschen Wetterdienst generierten Daten werden so verlässliche Vorhersagen zu möglichen Überschwemmungsrisiken in der Nationalparkregion bereitgestellt. „Wir wünschen uns, dass der Sensor niemals so anschlägt, dass wir ein Problem haben. Aber falls sich wirklich einmal eines anbahnt wäre der Wunsch, dass uns der Sensor frühzeitig so informiert, dass wir die Vorkehrungen treffen können, damit kein Schaden an Menschen, Gebäuden oder Liegenschaften entsteht“ sagt Karlheinz Roth, Bürgermeister der Gemeinde Spiegelau.
Aus diesem System ergeben sich weitere Ziele für die Forschung. Zum einen könnte der Verkehr mithilfe von intelligenten Schildern schneller umgeleitet werden. Zum anderen wurde ebenfalls im Rahmen des Projekts 5GNPR ein autonomer Bus entwickelt, um den Tourismusverkehr zu erleichtern. Dieser könnte anhand einer Verknüpfung mit den Messdaten der Pegelsensoren erkennen, dass er seine programmierte Route nicht wie gewohnt fahren kann. Bürgermeister Karlheinz Roth begrüßt, dass zunehmend Hochschulforschung und Projekte, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen, nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch bei ihnen im ländlichen Raum stattfinden.

Die ILE Nationalparkgemeinden sollen digitaler werden - im Fokus steht die kommunale Verwaltung in den Bereichen Städtebau und Mobilität. Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) und Planungsbüros unterstützen die ILE-Gemeinden seit einigen Monaten dabei. Jetzt sind die Ideen der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Denn ihnen soll die Digitalisierungsinitiative zugute kommen.
Ein erster Workshop mit den Bürgermeistern und eingeladenen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden Bayerisch-Eisenstein, Lindberg, Frauenau, Spiegelau, St. Oswald-Riedlhütte und Neuschönau fand im April in Spiegelau statt. Es geht nun mit einzelnen Workshops in den sechs Gemeinden weiter. Der Erste findet am 4. Juli in Bayerisch Eisentstein statt. Zusammen mit interessierten Personen aus der Bevölkerung sollen die Bedingungen und Bedürfnisse vor Ort erarbeitet werden. Ihre Anregungen fließen direkt in das Projekt ein. Je Gemeinde ist ein Workshop geplant. Anmelden können sie sich per E-Mail an hana.elattar@th-deg.de mit dem Betreff „IDEK“ und dem Namen der Gemeinde.
Das Integrierte Digitale Entwicklungskonzept (IDEK) ist Teil der vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr initiierten Initiative ‚Smart Cities - Smart Regions Bayern‘. In dieser Initiative ist die Digitale Region Nationalparkgemeinden (DiRegioN) als eine der Modellregionen ausgewählt worden.

Beteiligungsprozesse sind in der Stadtentwicklung ein wohlbekanntes Instrument, um Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung des täglichen Lebensraumes teilhaben zu lassen. Auch in Schulen wird digitale Beteiligung in Zeiten von Corona ein immer größeres Thema. Dieses geht die Technische Hochschule Deggendorf (THD) mit dem Projekt „inSCHOOL – Digitale Beteiligungsprojekte mit PUBinPLAN in der Schule“ an.
Die digitale Plattform PUBinPLAN bietet Lösungen für Beteiligungsprozesse in Schulen und ermöglicht Schülerinnen und Schülern in einem digitalen Schonraum ganz nebenbei einen spielerischen Umgang mit neuen Kommunikationsmedien. Dazu fand kürzlich unter Leitung von Professor Dr. Roland Zink, Initiator der Plattform PUBinPLAN, und Christian Schläger, Leitung der Jugendförderung der Hans Lindner Stiftung, ein digitaler Workshop zur Nutzung von PUBinPLAN für Beteiligungsprozesse in Schulen statt. An dem Workshop nahmen Vertreterinnen und Vertreter von Grundschulen über Mittelschulen bis Berufsschulen, wie auch des MINT-Teams der THD teil. In dem Workshop erklärte Prof. Dr. Roland Zink, wie PUPinPLAN funktioniert, stellte einige Projekte von Schulen vor und entwickelte mit den Teilnehmenden erste Projektideen für das kommende Schuljahr.
Gemeinsam mit der Hans Lindner Stiftung, die seit einiger Zeit eine Lehrerfortbildung zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung anbietet, dem Technologie Campus Freyung (TCF)
und dem Nachhaltigkeitslabor der THD, verortet am European Campus Rottal-Inn, möchte Prof. Dr. Roland Zink das Thema digitale Beteiligung an Schulen weiter vorantreiben. Im Schuljahr 2022 sind daher an verschiedenen Schulen der Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer digitale Beteiligungsprojekte zu den Themen Demokratie und Werteerziehung, digitale Medienkompetenz und Bildung für Nachhaltige Entwicklung geplant. Diese Themen sind aktueller denn je und das Projekt spricht mit den Themen genau die didaktischen Zielsetzungen von Schulen an. Für März 2022 ist in Kooperation mit der Hans Lindner Stiftung und dem Nachhaltigkeitslabor der THD eine Lehrerfortbildung für PUBinPLAN geplant, sodass im Sommerschuljahr die ersten Projektideen aus dem Workshop umgesetzt werden können. Als Pilotschulen für die Projekte im Frühjahr bzw. Sommer konnten schulartübergreifend Schulen gewonnen werden. Hierzu zählen die Don Bosco-Schule Passau (K-Schule), die Grundschule Moos, die Mittelschule Wallerfing, die Mittelschule St. Martin Deggendorf, die Realschule Plattling, das Gymnasium Eggenfelden, das Gymnasium Pfarrkirchen sowie das Staatliche Berufliche Schulzentrum Kelheim.
PUBinPLAN, ausgeschrieben Public in Spatial Planning supported by information and communication technology, ist eine digitale Beteiligungsplattform. Die Anwendung wurde in einem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der THD gefördert und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programmes FHprofUnt entwickelt. Seit 2017 steht PUBinPLAN auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Seitdem findet PUBinPLAN großen Anklang und bedient mittlerweile weitere Felder, wie digitale Beteiligung in der Planung, in der Wissenschaft und Forschung, im Bauwesen, in der Geschichtsdokumentation und auch in der Schule. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft fördert aktuell die anwendungsorientierte Evaluierung.

Forschende der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) verfolgen in einem neuen Projekt seit kurzem den Gedanken, Ladesäulen für E-Fahrzeuge mulitfunktional auszustatten und daraus einen Mehrwert für Nutzer, Städte, Gemeinden und Betreiber zu generieren. Klassische Ladesäulen für E-Fahrzeuge sieht man inzwischen häufig auf öffentlichen Flächen/Parkplätzen. Sie sind für jedermann zugängig. Auto einfach anschließen, bezahlen und aufladen bzw. tanken. Theoretisch könnten Ladesäulen aber mit viel mehr Funktionen als nur dem reinen Laden ausgestattet werden. Dies wird im Projekt mit dem Titel „CrossChargePoint“, das dem Technologie Campus Freyung zugeordnet ist, untersucht.
Zum Beispiel könnten dort, wo Ladesäulen installiert werden, zusätzliche Energiespeicher entstehen. Daraus ergeben sich viele Vorteile: Schwankende Anforderungen an das lokale Stromnetz könnten besser abgefangen werden. Die schnelle und gleichzeitige Aufladung mehrerer Elektrofahrzeuge ist möglich. Oder die Energie wird durch Elektrolyse und Power-to-Gas umgewandelt, so dass gas- oder wasserstoffbetriebene Fahrzeuge ebenfalls betankt werden können. Im Projekt „CrossChargePoint“ werden dabei die speziellen Anforderungen verschiedener Regionen durch unterschiedliche geografische, klimatische und wirtschaftliche Bedingungen berücksichtigt. Dies und die Entwicklung eines Prototyps, der in Zukunft mit nur wenigen Anpassungen in einem größeren Maßstab anwendbar sein soll, stellt die Hauptherausforderung des Projekts dar. Für das Projekt haben sich zehn Partner aus vier verschiedenen Ländern zusammengetan. Experten aus Israel, Österreich, Deutschland und der Schweiz, aus verschiedenen Unternehmen und Forschungsinstituten werden in den nächsten drei Jahren zusammen an der Entwicklung dieses Elektromobilitätsprojekts arbeiten. Das Team aus Freyung ist für die Entwicklung der Simulations- und Planungssoftware verantwortlich. Für die Planung und den Betrieb eines CrossChargePoints werden Bedingungen gesammelt und in das Simulations- und Optimierungstool integriert, das durch Eingabe der erforderlichen Daten die optimalen Standorte, Größen und Technologien - wie z. B. ein Energiemanagementsystem - für neue CrossChargePoints spezifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf der Entwicklung eines Plans, um den einfachen Energietransfer in andere Regionen mit unterschiedlich wirtschaftlichen, infrastrukturellen und geografischen Bedingungen zu ermöglichen. Für das Team des Technologie Campus in Freyung bietet dieses Projekt unter Leitung von Professor Dr. Javier Valdes eine großartige Chance, Themenfelder voranzutreiben, an denen schon in den letzten Jahren im Verkehrs- und Energiesektor gearbeitet wurde. Dazu hat Professor Dr. Wolfgang Dorner, der Leiter des Technologie Campus Freyung, ein Team mit umfassender Erfahrung durch die Entwicklung von Projekten wie Increase, Cross Energy oder e-Road aufgebaut. Gefördert wird das Projekt über das Programm Horizon 2020 der Europäischen Union.

Was haben nachhaltige Entwicklung und Innovation mit Künstlicher Intelligenz gemeinsam: Prof. Dr. Javier Valdes. Er ist der neue Experte für BigGeoData und Spatial AI an der Technischen Hochschule Deggendorf (THD).
Prof. Valdes generiert Anwendungen für eine nachhaltige Entwicklung durch den Einsatz von BigGeoData. Was sich kompliziert anhört ist eigentlich ganz einfach: Durch Sammeln und Auswerten von Geodaten, also digitalen geografischen Daten, trägt Prof. Valdes zu Nachhaltigkeit bei. Da das Fachgebiet nicht immer geläufig ist, erklärt er es gerne anhand eines Beispiels. Durch das Sammeln von großen Datenmengen kann Valdes Rückschlüsse auf den Stromverbrauch und die Energieversorgung ziehen und Prognosen abgeben, wie die Nachfrage zu einem gewissen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein wird und wie der Energiebedarf bestmöglich gedeckt werden kann.
Dass moderne Technologie richtig genutzt die Bedürfnisse der Menschen und der Ökosysteme in denen wir leben gleichermaßen bedienen kann ist für Prof. Valdes einer der Gründe, die ihn in seiner Forschung antreiben. Ein großer Pluspunkt ist es außerdem, dass persönliche und berufliche Interessen in seinem Fachgebiet zusammenfließen. An der THD schätzt er besonders die Freiheit und Unterstützung bei der Entwicklung von Forschungsprojekten sowie den engen Kontakt zu den Studierenden, der an der THD über den Austausch in Seminaren und Vorlesungen hinaus geht. Eine besondere Bereicherung ist für ihn dabei die Beteiligung Studierender an Forschungsvorhaben in Form von Praktika oder Abschlussarbeiten. Seine Hauptaufgabe sieht Valdes daher auch darin, den Studierenden nicht nur die Theorie zu vermitteln, sondern sie auch mit der Forschungspraxis vertraut zu machen. Er sieht sich gerne als Vermittler, der die Arbeit der Studierenden auf eine zugängliche Art und Weise auf das lenkt, was sie interessiert, ohne dabei die wissenschaftliche Rigorosität aus den Augen zu verlieren.
An der Fakultät für Angewandte Informatik möchte er sich gerne an der Entwicklung der Fakultät beteiligen und neue Projekte für Studierende einführen, die mit der Nutzung von BigData zu tun haben. Besonders die Sichtbarkeit des Campus und der Arbeitsgruppe als spezialisiertes Zentrum auf internationaler Ebene im Bereich der Spatial AI liegen Prof. Valdes am Herzen. Ein Augenmerk liegt daher auf der Möglichkeit gemeinsam mit Unternehmen neue Geschäftskonzepte und Technologien zu entwickeln, die auf dem neuesten wissenschaftlichen und technischen Fortschritt basieren, sowie attraktive Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung von lokalen und internationalen Talenten zu bieten.
Internationalität spielt eine tragende Rolle im Leben des gebürtigen Spaniers. Aufgewachsen in Madrid, orientierte er sich zum Studium ins europäische Ausland. Bevor er nach Freyung in die Forschung ging war er an Hochschulen in Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland, was ihn nachhaltig prägte. Die drei Jahre an der Universität Ferrara in Italien haben Valdes besonders beeindruckt. In einer kleinen Stadt gelegen, aber mit Professoren von großem Format, international gut vernetzt und einer starken Verbindung zur Stadt und ihren Bewohnern. Gerade die Arbeit im internationalen Umfeld haben ihm gezeigt, wie viele verschiedene Herangehensweisen es gibt und wie unterschiedliche Perspektiven, auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen, am Ende trotzdem zum Ziel führen.
Auch wenn er international viel herum gekommen ist und schon seit Jahren nicht mehr in Spanien wohnt, so hat er sich doch seinen mediterranen Charakter bewahrt. Fokussiert auf das Wesentliche bringt er viel voran, wobei sein Büro dafür manchmal im Chaos versinkt. Trotz südländischem Temperament genießt er auch die bayerische Gemütlichkeit. Nach der Arbeit entspannt er gerne mit Freunden im Biergarten. Außerdem liebt er Filme, wobei er eine Schwäche für Science Fiction hat und spielt seit seiner Jugend leidenschaftlich gerne Rugby.

Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) hat Verstärkung für die Lehre und Forschung auf dem Gebiet Bionik gefunden. Seit 1. März vertritt Dr. Kristina Wanieck die Professur mit dem Schwerpunkt „Bionik und Innovation“. 2009 hat sie begonnen, den Forschungsbereich Bionik am Technologie Campus Freyung aufzubauen und sich dabei zu einer international anerkannten Wissenschaftspersönlichkeit entwickelt. Ihr Wissen und ihre Erfahrung will sie nun als Professorin in neue Projekte einbringen, die Forschung an der THD ausbauen und Studierenden das richtige Anwenderwissen vermitteln.
Bionik bedeutet, Wissen aus der Biologie zu nutzen, um praktische und oft technische Probleme zu lösen. Zu Beginn von Kristina Waniecks Tätigkeit am Technologie Campus Freyung stand die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft im Vordergrund und es wurde an einem regionalen Bionik-Netzwerk gearbeitet. Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wurde bald eine Forschungslücke entdeckt und die studierte Biologin begann ihre Doktorarbeit in Kooperation mit der TU München. Während ihrer Promotion hat sie sich auf die methodische Vorgehensweise der Bionik konzentriert: „Ich wollte mit meiner Arbeit erreichen, dass die Bionik im Alltag von Unternehmen ankommt und so leicht einzusetzen ist, dass sie messbare Erfolge bewirkt.“ 2019 gehörte sie aufgrund dieses Ansatzes zu rund 25 Experten, die von der NASA nach Cleveland, Ohio eingeladen wurde. Zwei Tage arbeitete die Expertengruppe zusammen daran, der Bionik eine stärkere Bedeutung in der Anwendung zu geben. „Fast jeder, den ich in den letzten Jahren international treffen und kennenlernen durfte, trägt einen wichtigen Baustein zum Gesamtbild der Bionik bei. Insofern ist es diese Zusammenarbeit mit vielen interessanten Kollegen, die mich antreibt“, sagt Kristina Wanieck. Weitere Fachkollegen traf sie als Gastwissenschaftlerin in Frankreich und Kanada. Ebenso im Rahmen ihrer Tätigkeit im internationalen Standardisierungsverfahren für Bionik oder im VDI-Gremium zur Bionik.
Für ihre Zeit als Professorin wünscht sie sich, dass ihre Arbeit zu erfolgreichen Projekten und Publikationen führt und damit auch der Ruf der THD nach außen gestärkt wird. Die Lehre möchte sie mit viel Begeisterung und Freude angehen und den Studierenden so viel Erfahrung und Wissen wie möglich vermitteln: „Wenn ich Bionik lehre, dann sollen die Studierenden eine Zusatzqualifikation erhalten, die sie später in der Praxis anwenden können.“ Seit ihrer Initativbewerbung am Technologie Campus Freyung vor über 10 Jahren hat ein Schritt den anderen ergeben. Ihren Beruf lebt Kristina Wanieck mit Hingabe und plant, noch viele ihrer Visionen wahr werden zu lassen. Lustigen und erfüllenden Ausgleich findet die Zweifach-Mama bei ihrer Familie, außerdem beim Joggen und Yoga.

Wildunfälle enden für Tiere sehr häufig tödlich, während die meisten daran beteiligten VerkehrsteilnehmerInnen mit einem Schrecken und einem Sachschaden am Fahrzeug davonkommen. Aufwand, den Versicherungsschaden zu melden ist es trotzdem und gleichzeitig hat nicht nur die Tierwelt, sondern auch der Jäger Verluste zu vermelden. Was also tun, damit es erst gar nicht zu so einem Unfall kommt? Dieser Fragestellung ist ein Forschungsteam am Technologie Campus Freyung zusammen mit der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und dem Nationalpark Bayerischer Wald gemeinsam mit der wuidi GmbH nachgegangen. Sie haben in den letzten drei Jahren im Rahmen des Projektes WilDa Algorithmen und Modelle entwickelt, die es mittels Künstlicher Intelligenz ermöglichen, Wildunfälle vorherzusagen. Durch diese Methoden des Maschinellen Lernens kann für die VerkehrsteilnehmerInnen berechnet werden, ob zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Straßenabschnitt ein Risiko für einen Wildunfall besteht. Diese Algorithmen wurden mit den bekannten Unfällen auf Bayerns Straßen der letzten zehn Jahre angelernt und mit verschiedenen räumlichen und zeitlichen Verkehrs-, Unfall- und Umweltdaten ergänzt. Verschiedene Muster für ein erhöhtes Unfallrisiko wurden erkannt, die dann als Eingangsdaten für das maschinelle Lernverfahren genutzt wurden. Gerade die Datenvorbereitung war dabei aufwändiger als zunächst angenommen, da manche Informationen nicht genau nach Standort erfasst sind. Beispiele dafür sind Barrieren in Form von Zäunen oder Leitplanken. Mit Hilfe von vorhandenen Kamerabefahrungen der Bayerischen Obersten Baubehörde wurde durch Deep Learning Methoden und der Verfahren der Geoinformatik eine verortete Infrastrukturdokumentation geschaffen. Diese konnte mit vielen anderen Eingangsdaten für den Lernalgorithmus verwendet werden. Welchen Einfluss sie auf das Wildunfallrisiko haben können, haben die Analysen der Freyunger Forscher für ihr Testgebiet gezeigt. Auch die Nähe zum Wald in Kombination mit zeitlichen Aspekten, wie Sonnenstand, aber auch die Breite der Straße waren Faktoren, die das Unfallrisiko entscheidend beeinflussen. Auf Bundes- und Staatsstraßen geschehen im Verhältnis zur Straßenlänge die meisten Unfälle, dort ist das Risiko also höher. Einzelne Einflussfaktoren sind weniger für eine gute Vorhersage der Unfälle entscheidend, sondern die Kombination aller Verkehrs-, Unfalls-, Wetter- und Landnutzungsdaten, mit denen die Algorithmen trainiert und getestet wurden. Damit ist ein sinnvoller Schritt getan, um Verkehrsteilnehmer gezielt zu warnen. Der Ideengeber, die wuidi GmbH hat dafür eine Wildwarn-App entwickelt. Die App kann auf jedem Smartphone installiert werden. Der Autofahrer wird während der Autofahrt bei einem hohen Unfallrisiko rein akustisch gewarnt. In Zukunft soll der Warnalgorithmus auch auf andere Bundesländer Deutschlands angewandt werden. Auf lange Sicht hat das Team eine europaweite Vorhersage in integrierten Navigationsgeräten zum Ziel. Gefördert wurde das Projekt WilDa durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Über das Förderprogramm mFUND wurden insgesamt 1,1 Mio. Euro für die Forschungsarbeiten zur Verfügung gestellt.

5G steht für die „fünfte Generation des Mobilfunks“ und ist die Weiterentwicklung des existierenden 4G Mobilfunknetzes. 5G bietet neue Ansätze der Informations- und Datenübertragung, unter anderem für die Erhöhung der Bandbreite und die Verringerung von Latenzzeiten, sodass die Datenübertragung verzögerungsfreier und schneller wird. Dadurch ermöglicht 5G viele neue Anwendungszwecke, z. B. im Industriebereich für die Kommunikation von Maschinen, im Gesundheitssektor für Telemedizinanwendungen, der öffentlichen Verwaltung, der Mobilität, wie für autonomes Fahren, oder im Infrastrukturmanagement.
5G benötigt noch weitere Forschung, um diese neuen Einsatzfelder zu definieren und 5G optimal nutzen zu können. Unter der Leitung des Technologie Campus Freyung werden daher an den Hochschulstandorten Freyung, Cham und Deggendorf sogenannte Campusnetze als Versuchsnetze für 5G-Anwendungen errichtet. Diese bieten in einem eng abgesteckten Bereich unter Einhaltung sämtlicher Richtlinien die Möglichkeit, unter komplett eigener Verwaltung 5G-Funkzellen zu betreiben. Diese stehen dann für Forschung und Entwicklung zur Verfügung. Zudem wird am Technologie Campus Freyung im Rahmen des Projektes modernes Mess- und Testequipment für 5G-Anwendungen aufgebaut. Dieses steht dann für Kooperationen mit Unternehmen sowie als Basisinfrastruktur für weitergehende Forschungsvorhaben im nationalen und internationalen Rahmen zur Verfügung Entsprechende Versuchsumgebungen sind bisher nur an großen Forschungsinstituten und Universitäten in Ballungszentren verfügbar. Mit dem Aufbau der Infrastruktur in Freyung, können regionale Unternehmen und Startups an die neue Technologie herangeführt werden, damit diese frühzeitig von den Potentialen von 5G profitieren können. Der Aufbau der Infrastruktur im Projekt „Grenzland 5G“ wird bis Februar 2021 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms FH Invest 2020 mit 913.000 Euro gefördert.

Zivile Drohnen werden mittlerweile für vielfältige Anwendungen benutzt und sind darüber hinaus zu einem beliebten Hobby geworden. Sie können aber auch zur Gefahr werden, wenn sie missbräuchlich verwendet werden. So kann es zu Schäden durch Abstürze kommen, Flugverbotszonen können unbewusst missachtet werden oder Drohnen können vorsätzlich für Straftaten verwendet werden.
Um diesen Gefahren zu begegnen, ist am Technologie Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf in den vergangenen drei Jahren das Forschungsprojekt ArGUS durchgeführt worden. Das Akronym steht für ein Assistenzsystem zur situationsbewussten Abwehr von Gefahren durch UAS (Unmanned Aerial Systems, englisch für unbemannte Flugsysteme). Das Kooperationsprojekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit" mit insgesamt 1,9 Mio. € gefördert. Neben dem Technologie Campus waren auch das Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe, die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der Verband für Sicherheitstechnik (VfS) das European Aviation Security Center (EASC) sowie die beiden Industrieunternehmen Securiton GmbH und Atos Information Technology GmbH Teil des Projektkonsortiums. Zudem waren das Bayerische Landeskriminalamt, das Bundeskriminalamt, der private Sicherheitsdienstleister Power Personen-Objekt-Werkschutz GmbH sowie der Flughafen Frankfurt als assoziierte Partner am Projekt beteiligt.
Ziel des Projektes war die Entwicklung eines Assistenzsystems, das in der Lage ist Drohnen frühzeitig zu detektieren und zu klassifizieren sowie eine Lage- und Risikobewertung durchzuführen. Solch eine Situationsanalyse ist ein sehr wichtiger Bestandteil, wenn es um den Schutz von Menschen und Infrastruktur geht. Dabei werden alle verfügbaren Informationen berücksichtigt und es können rechtlich abgesicherte Handlungsvorschläge für Gegenmaßnahmen generiert werden. Dadurch können z.B. Einsatzkräfte eine potenzielle Bedrohung sehr früh erkennen, die Auswirkungen abschätzen und nach kurzer Reaktionszeit zu einer bestmöglichen Entscheidung hinsichtlich geeigneter Gegenmaßnahmen gelangen. Während der Projektlaufzeit wurden mehrere Tests der Komponenten unter realitätsnahen Bedingungen, beispielsweise im Hamburger Volksparkstadion, der Paderborner Benteler-Arena und am Flughafen Frankfurt-Hahn durchgeführt.
Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) hat sich im Projekt mit der Detektion und Analyse der Kommunikation zwischen Drohne und Bodenstation befasst. Dafür wurden Sensorsysteme entwickelt, die Signale der Drohnen erfassen und auswerten können. Die Funkverbindung zwischen einer Drohne und der Bodenstation wird direkt beim Einschalten der Geräte aufgebaut. Dadurch ist es möglich, Funksignale einer Drohne im Idealfall bereits vor deren Start zu identifizieren. Der so gewonnene Zeitvorteil gegenüber anderen Detektionsverfahren, wie zum Beispiel Radar, gibt Einsatzkräften mehr Reaktionszeit und kann im Ernstfall essenziell sein. Neben der frühzeitigen Detektion einer Drohne liefert das entwickelte System auch hilfreiche Informationen über die noch vorhandene Reichweite und mögliche Wegpunkte einer identifizierten Drohne. Dem Assistenzsystem kann somit noch vor dem Abheben die Präsenz und Flugroute einer Drohne übermittelt werden.
Die ursprünglich am Flughafen Frankfurt-Hahn geplante Abschlussveranstaltung mit Live-Demonstrationen des ArGUS-Systems konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurden die Projektergebnisse im Juni 2020 im Rahmen eines digitalen Abschlussevents vor Behörden- und Industrievertretern präsentiert.
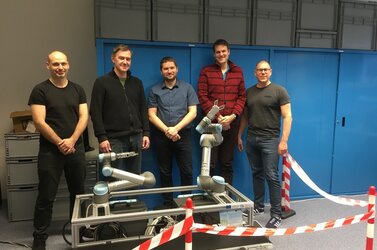
Die Stromversorgung ist immer mehr eine Mischung verschiedener Energiequellen, insbesondere seit der Anteil von erneuerbaren Energien zunehmend wächst. Dadurch entstehen im Tagesverlauf teilweise unvorhergesehene Lastspitzen oder auch Bedarfslücken, die dem Stromnetz eine hohe Dynamik und Flexibilität abverlangen. Damit ein heutiges Stromnetz unter diesen Voraussetzungen nachhaltig, stabil und intelligent agieren kann, benötigt es eine sehr komplexe Infrastruktur, das so genannte Smart Grid. Neue Technologien, wie eine dynamische Laststeuerung, versuchen dabei Angebot und Nachfrage effizient aufeinander abzustimmen. Am Technologie Campus Freyung beschäftigte sich das Projekt „Smart Grid Technologien für ländliche Gebiete und KMUs“ mit dem Thema „Intelligentes Stromnetz der Zukunft“. Das Hauptforschungsgebiet war dabei die dynamische Laststeuerung. Diese soll es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erleichtern, neue Prozesse bei sich umzusetzen und somit Energiekosten zu senken. Im Projekt arbeiteten die Universität Budweis in Tschechien mit dem Technologie Campus Freyung als Projektpartner zusammen. Die beiden Hochschulstandorte haben ein gemeinsames grenzübergreifendes Labor aufgebaut, das die Simulation eines typischen Industrie 4.0-Unternehmens mit einem intelligenten Stromnetz ermöglicht. In Freyung steht dazu eine Industrie 4.0-Roboteranlage, die als „digitaler Zwilling“ in die Stromnetz-Simulation am Standort Budweis integriert werden kann. Eine intelligente Strommessung ermöglicht beispielsweise eine Reaktion auf eine gerade geringe Auslastung von Maschinen in der Fabriksimulation oder auch auf Lastspitzen. Dazu werden die realen Energieverbrauchsdaten der Industrie 4.0-Anlage in Freyung an die Netzsimulation in Budweis gesendet und fließen dort mit in die Berechnungen ein. Ebenso kann auf die Verbrauchsempfehlungen anhand aktuell verfügbarer Energie durch die Simulation reagiert werden, wodurch sich der Energieverbrauch der Maschinen anpassen lässt. Das gemeinsam aufgebaute Labor steht weiterhin für Kooperationen mit Unternehmen sowie für Forschung und Lehre zur Verfügung. Für KMU ist eine Simulation mit individuellen Industrie-Prozessen möglich. Die erhobenen Stromdaten können beispielsweise auch für weitere Berechnungen im Hinblick auf eine vorausschauende Wartung von Industrie 4.0-Anlagen in KMUs verwendet werden. Das Kooperationsprojekt „Smart Grid – Technologien für ländliche Gebiete und KMUs“ wurde durch die Europäische Union „Ziel ETZ Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2014-2020 (Interreg V)“, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung mit einer Summe von rund 750 000 Euro innerhalb einer Projektlaufzeit von drei Jahren gefördert und am 31. März 2020 erfolgreich abgeschlossen.

2009 wurde der Technologie Campus Freyung eröffnet und war damit Teil der Technologieregion Bayerischer Wald. Die Vision der Technischen Hochschule Deggendorf war es, die ländliche und touristisch geprägte Region des Bayerischen Waldes durch Wissenschaft und Forschung in ihrer Innovationskraft zu stärken. Und das im engen Zusammenspiel von Wirtschaft und Hochschule. Für diese Vision erhielt die Technische Hochschule Deggendorf 2010 den Bayerischen Gründerpreis und heute, zehn Jahre später, ist diese Vision zur Realität geworden. Der Technologie Campus Freyung beschäftigt 29 Mitarbeiter und 4 Professoren. Die Forschung konzentriert sich auf die Bereiche Angewandte Informatik und Bionik, sodass Themen wie Energiewende, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder nachhaltige und umweltschonende Innovation bearbeitet werden. In zahlreichen Projekten und internationalen Kooperationen tragen die Wissenschaftler ihre Ergebnisse in die ganze Welt und beteiligen sich an aktuellen Entwicklungen. Insbesondere ist der Technologie Campus auch ein Impulsgeber für die Region, wie Wissenschaftsminister Bernd Sibler beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen betonte: „Der Technologiecampus Freyung der TH Deggendorf zählt zu den Pionieren unserer Technologietransferzentren und steht mustergültig für den Erfolg unserer Regionalisierungsstrategie. Hier wird deutlich, welche wertvollen Synergieeffekte sich durch die anwendungsorientierte Forschung für die Hochschule und Unternehmen ergeben können. Mit ihrer gezielt auf die Wirtschaftsstruktur der Region abgestimmten Ausrichtung sind Technologietransferzentren wie der TC Freyung starke Innovationsmotoren. Sie gestalten den Fortschritt vor Ort maßgeblich mit.“ Auch die anderen Ehrengäste des Festaktes, Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Sperber, Landrat Sebastian Gruber, Bürgermeister der Stadt Freyung, Dr. Olaf Heinrich und Campusleiter Prof. Dr. Wolfgang Dorner fanden in Ihren Ansprachen ähnliche Worte und zeigten sich mehr als zufrieden mit der Entwicklung in Freyung.

Forschung und Technologie für das Wohl aller, steht an der Auffahrt zum Glenn Research Center der NASA in Cleveland, Ohio. Anfang September hat eine Forschungsgruppe dort rund 25 Experten eingeladen, um gemeinsam die Bionik als Methodik weiterzuentwickeln. Wissenschaftler und Industrievertreter aus den USA und Kanada nahmen teil, und mit Kristina Wanieck von der Arbeitsgruppe Bionik war auch der Technologie Campus Freyung vertreten. Bionik ist die Verbindung aus Biologie und Technik, bei der man versucht, von Vorbildern aus der Biologie für technische und praktische Probleme zu lernen. „Man bekommt nicht jeden Tag eine persönliche Einladung von einer Institution wie der NASA. Ich war zunächst überrascht und habe mich dann sehr gefreut, zu dem ausgewählten Kreis zu zählen“, beschreibt Kristina Wanieck ihren ersten Eindruck, als die E-Mail im Postfach einging. Seit zehn Jahren arbeitet sie am Technologie Campus Freyung und hat dort die Arbeitsgruppe Bionik mit aufgebaut. Zu Beginn ihrer Tätigkeit stand die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft im Vordergrund und es wurde an einem regionalen Bionik-Netzwerk gearbeitet. Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wurde bald eine Forschungslücke entdeckt und Wanieck begann ihre Doktorarbeit in Kooperation mit der TU München. Während ihrer Promotion hat sie sich auf die methodische Vorgehensweise der Bionik konzentriert: „Ich wollte mit meiner Arbeit erreichen, dass die Bionik im Alltag von Unternehmen ankommt und so leicht einzusetzen ist, dass sie messbare Erfolge bewirkt. Einen ersten Schritt in diese Richtung konnten ich mit meiner Arbeit gehen, dank der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen an der Hochschule und mit unseren internationalen Kooperationen. Es liegt aber noch einiges vor uns.“ Bei dem Treffen in den USA hatte Wanieck auch die Chance, die Arbeit aus Freyung in einem Vortrag vorzustellen und auf aktuelle Projekte hinzuweisen, wie den vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz finanzierten Projektverbund BayBionik. „Die Resonanz auf unsere Arbeit war enorm positiv. Uns war gar nicht bewusst, dass die Ergebnisse, die wir in den letzten zwei Jahren veröffentlicht haben, in Amerika auf solche Beachtung und Wertschätzung gestoßen sind und für einige der anwesenden Teilnehmer richtungsweisend waren“, beschreibt Wanieck das Feedback auf die Arbeit aus Freyung. Zusammen mit den verschiedenen Wissenschaftlern und Vertretern der Wirtschaft hat Wanieck bei dem gemeinsamen Treffen zwei Tage lang daran gearbeitet, wie die Bionik eine stärkere Bedeutung in der Anwendung erhält. Genau damit beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Bionik in Freyung schon seit vielen Jahren und arbeitet für und mit der Wirtschaft daran, bionische Arbeitsmethoden praxisnäher zu gestalten. "Das Potenzial der Bionik ist sehr gut bekannt. Nur fehlt es bisher an einer breiten Akzeptanz und Umsetzung dieser Zukunftsdisziplin. Uns war schon immer klar, dass wir das nur in internationaler Zusammenarbeit erreichen können. Umso mehr freut es uns, dass die NASA uns eine solche Plattform zum Austausch geboten hat“, fasst Wanieck die Bedeutung des Treffens zusammen. Die ersten Folgeprojekte sind bereits in der Planung und das Treffen ist ein Meilenstein für die weitere Arbeit in Freyung.

TC Freyung koordiniert neuen bayerischen Projektverbund zum Thema Bionik
Der Schutz der Umwelt wird immer wichtiger. Der neue bayerische Projektverbund „BayBionik – Von der Natur zur Technik“ erforscht, wie biologische Vorbilder für technische Innovation genutzt werden können und entwickelt Produkte umweltschonend und nach dem Vorbild der Natur. Fünf bayerische Hochschulen und Universitäten bündeln ihre Kompetenzen in diesem Verbund. Der Technologie Campus Freyung, Teil der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), hat die Koordination des neuen Projektverbunds inne.
„Für alle beteiligten Projektpartner ist „BayBionik“ eine große Chance. Wir können durch die Forschung aktiv zum technischen Umweltschutz beitragen, indem innovative Produkte und Prozesse entwickelt werden. Und wir können im Projektverbund gemeinsam daran arbeiten, die Bionik stärker auf den Umweltschutz auszurichten und damit langfristig zu ihrem Erfolg als nachhaltige Innovationsstrategie beitragen“, fasst Kristina Wanieck vom TC Freyung die Bedeutung von „BayBionk“ zusammen. Sie und ihre Kollegin Kirsten Wommer koordinieren den Projektverbund. Wommer hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit in der Bionik hervor: „Von der Biologie für Technik zu lernen, erfordert interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Deshalb motivieren wir unsere Projektpartner, aktiv Synergien zu nutzen“, erklärt Wommer.
Ziel des Projektverbundes ist es, technische Produkte durch das Lernen von der Natur umweltverträglich herzustellen und damit unter anderem Ressourcen zu schonen, Verschmutzungen der Umwelt einzudämmen und Energie in Produktionsprozessen einzusparen. Die Schwerpunkte von „BayBionk“ sind selbstreinigende, nachhaltige Oberflächen und intelligente, ressourceneffiziente Systeme. Es sollen leicht zu reinigende Oberflächen für die Automobilbranche, Antihaft-Beschichtungen für Schiffe oder auch neue Materialien wie Biokeramik umweltschonend entwickelt werden. Auch energieeffizientere Maschinen sowie neuartige „Glasfaserkabel“ aus umweltfreundlichen, ungiftigen und biologisch abbaubaren Substanzen werden im Projektverbund erforscht und hergestellt. Das Besucherzentrum Bionicum im Tiergarten Nürnberg begleitet die Projekte und macht die Bionik-Forschung für die Öffentlichkeit erlebbar.
Am Projektverbund beteiligt sind neben der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), das Bionicum Nürnberg, die Universität Bayreuth, die Technische Universität München am Standort Straubing (TUM Straubing) und die Technische Hochschule Nürnberg (TH Nürnberg). Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz finanziert im Rahmen des Verbunds sechs Forschungsprojekte sowie ein Koordinierungs- und ein Begleitvorhaben mit rund 1,8 Millionen Euro.
Bild: Kirsten Wommer (l.) und Kristina Wanieck (r.) vom Technologie Campus Freyung koordinieren den Projektverbund BayBionik.

Der Bayerisch-Böhmische Grenzraum ist mit seinen weiten Naturflächen und den historischen Kulturstätten und Baudenkmälern eine reizvolle Region für das Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“. In dem Projekt geht es darum, diese Kulturgüter zu bewahren und in der modernen Zeit erlebbar zu machen. Dazu wird bis Ende September 2019 in dem Projekt, an dem der Technologie Campus Freyung beteiligt ist, eine App fürs Handy entwickelt. Die App präsentiert u.a. Wissenswertes zu den Denkmälern digital neu aufbereitet und anschaulich. Nun können diese historischen Schätze aber auch real erlebt werden: Zwischen dem 9. und 30. Juli 2019 werden im Haus der Europaregion Donau-Moldau in Freyung die gedruckten 3D-Modelle der Kulturgüter in einer Ausstellung präsentiert. Am 09. Juli wird die Projektleiterin vom Technologie Campus Freyung, Frau Dr. Mariann Juha, vor Ort sein und die Ausstellung eröffnen. „Die Ausstellung zeigt, was heute technisch alles möglich ist, um historische Kultur zu bewahren und aufzuwerten. So präsentiert die Ausstellung Jahrhunderte alte Objekte als 3D-Modelle und sie zeigt, wie diese Modelle in die technischen Medien von heute eingebunden sind. Das ist mehr als spannend und sollte man gesehen haben“, fasst Dr. Juha die Bedeutung der Ausstellung zusammen. Die Technische Hochschule Deggendorf am Standort Freyung hat in den letzten knapp drei Jahren zusammen mit der Westböhmischen Universität Pilsen und der gemeinnützigen Gesellschaft Uhlava an diesem Projekt gearbeitet. Neben der App als Reiseführer und einem Buch rundet die Ausstellung nun die erzielten Ergebnisse ab. Nach ihrem Gastauftritt in Freyung wird die Ausstellung im Grenzraum wandern, bevor sie dann im Herbst in der Bayerischen Repräsentanz in Prag ankommen wird. Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union Ziel ETZ Freistaat Bayern –Tschechische Republik 2014 –2020 (Interreg V) durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Projekt am Technologie Campus Freyung startet Umfrage zu Erfahrungen von Vekehrsteilnehmern
Alle zwei Minuten ereignet sich in Deutschland ein Wildunfall. Zu Dämmerungszeiten und nachts ist die Gefahr eines Zusammenstoßes mit einem Wildtier besonders hoch. Deshalb hat es sich der Technologie Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf mit dem Forschungsprojekt WilDa zur Aufgabe gemacht, die auslösenden Faktoren von Wildunfällen zu untersuchen. WilDa steht für „dynamische Wildunfallwarnung unter Verwendung heterogener Verkehrs- , Unfall-, und Umweltdaten sowie Big Data Ansätze“.
Gefördert wird das Projekt über das mFUND-Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit insgesamt 1,1 Mio Euro. Zu den Partnern zählen unter anderem der Nationalpark Bayerischer Wald und die wuidi GmbH. Zusammen wird an einem geeigneten Informationssystem gearbeitet und es werden Faktoren bestimmt, die Wildunfälle beeinflussen. Basierend auf diesen Faktoren wird das Unfallrisiko räumlich und zeitlich berechnet sowie Gefahrenschwerpunkte auf den Straßen identifiziert. Somit sollen stark unfallgefährdete Stellen künftig prognostiziert werden können. Ideengeber und einer der Projektpartner ist die wuidi GmbH mit ihrer Wildwarner-App, die basierend auf polizeilichen Unfallstatistiken die Nutzer vor einem erhöhten Wildwechsel auf den Straßen warnt. Im Falle eines Wildunfalls bietet sie ihren Nutzern außerdem einen Wildunfall-Service.
Das Projekt WilDa ist nun ins letzte Projektjahr gestartet. Aktuell wird im Rahmen des Projekts eine Umfrage zum Thema „Wildunfallwarnung und Navigationseinsatz im Auto“ durchgeführt, damit die Forschungsergebnisse den Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer entsprechend verwertet werden können. Jeder Interessierte kann durch Teilnahme an der Umfrage seine Erfahrungen mit Wildunfällen teilen und somit dazu beitragen, die Anzahl zukünftiger Wildunfälle zu verringern. Die Umfrage ist über die Webseite des Technologie Campus Freyung (www.tc-freyung.th-deg.de) erreichbar und für drei Wochen aktiv.
Das Bild zeigt von links PD Dr. Marco Heurich und Dr. Christian Hoermann vom Nationalpark Bayerischer Wald, Dr. Peter Hofmann, Alexander Faschingbauer, Prof. Dr. Wolfgang Dorner und Raphaela Pagany vom Technologie Campus Freyung sowie Alexander Böckl und Alfons Weinzierl von der wuidi GmbH. Über den QR-Code gelangt man direkt zur Umfrage.

Grenzüberschreitendes Projekt vernetzt Akteure entlang der Donau
Freyung. Die Region rund um die Donau bietet ein immenses Potenzial für erneuerbare Energien in Form von Biomasse. Für die Erforschung, die Bekanntmachung und die Nutzung dieses Potenzials haben sich Projektpartner aus ganz Europa zusammengeschlossen: das Projekt ENERGY BARGE vereint 15 Partner aus Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Österreich, Rumänien, Slowakei und Ungarn, die zusammen daran arbeiten, den Transport von Biomasse über die Donau zu stärken.
Potenzials haben sich Projektpartner aus ganz Europa zusammengeschlossen: das Projekt ENERGY BARGE vereint 15 Partner aus Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Österreich, Rumänien, Slowakei und Ungarn, die zusammen daran arbeiten, den Transport von Biomasse über die Donau zu stärken.
Für Deutschland sind neben der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. als Lead-Partner auch der Technologie Campus Freyung sowie der BioCampus in Straubing im Konsortium vertreten. Hier finden wichtige Projektarbeiten statt, die zu einer stärkeren Internetpräsenz des Donau-Raums beitragen. „Der Transport über die Donau ist kosteneffizient und umweltfreundlicher im Vergleich zu einem Transport auf den Straßen, welche dadurch zusätzlich entlastet würden. Wir möchten Firmen für den Transport auf der Donau begeistern und ihnen gleichzeitig zeigen, wo sie Häfen und Kooperationspartner entlang der Transportkette finden“, beschreibt Anne Weinfurtner vom Technologie Campus Freyung die Bedeutung des Projektes. Im Projekt wird besonderer Wert darauf gelegt, die Energiesicherheit und – effizienz in den Ländern entlang der Donau zu erhöhen. Dazu vernetzt es alle wichtigen Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Biomasse-Firmen, Donau-Häfen sowie relevante öffentliche Einrichtungen und politische Akteure. Ein wichtiges Treffen aller beteiligten und interessierten Akteure fand kürzlich in Bukarest statt. Bei einer zweitägigen Konferenz wurde das Projekt in Rumänien vorgestellt, die Partner haben das weitere Vorgehen festgelegt und interessierte Firmen konnten sich über den eigenen Nutzen informieren. Aus Freyung stellten Prof. Dr. Wolfgang Dorner und Projektmitarbeiterin Anne Weinfurtner die Ergebnisse ihrer Arbeit vor. Kernziel der Arbeit am Technologie Campus Freyung ist die Internetpräsenz von Firmen und Logistikpartnern entlang der Donau in den teilnehmenden Ländern technisch umzusetzen. Dazu können sich interessierte Firmen kostenlos auf der Webseite registrieren und präsentieren lassen. Die Arbeit an der Webseite ist aktuell die wichtigste Aufgabe am Technologie Campus Freyung, sodass die Webseite baldmöglichst erreichbar ist. „Die Konferenz hat gezeigt, wie wichtig das Projekt für die Donau-Region ist und wieviel Potenzial noch genutzt werden kann. Es wird Zeit, dass sich die Akteure und Firmen am Markt kennen und vernetzen, um wichtige Partner zu finden. Dafür arbeiten wir in dem Projekt“, fasst Frau Weinfurtner ihre Arbeit zusammen. Das Projekt wird durch das Interreg Danube Transnational Programme gefördert und läuft noch bis Sommer 2019.
Das Bild zeigt den Projektkoordinator Thies Fellenberg von der
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. bei der Projektvorstellung
Anfang Juni in Bukarest, Rumänien.

Neue Wege in der Digitalisierung für den Kulturtourismus
Die Digitalisierung hält immer mehr Einzug in den Alltag und bietet auch im Bereich des Tourismus neue Möglichkeiten für Planung und Durchführung von Reisen. Das am Technologie Campus Freyung durchgeführte Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“ (peregrinus.online) stellt Touristen, Pilgern, aber auch Einheimischen im bayerisch-tschechischen Grenzraum individuelle Informationen vor Ort zur Verfügung, um das Kulturgut in der Region zu erkunden.
Nun sollen im Rahmen des Projektes aktuelle Fragen zum Umgang mit digitalen Technologien im Kulturtourismus interdisziplinär bearbeitet werden.
Die Technische Hochschule Deggendorf (THD) veranstaltet dazu vom 09. bis 13. September 2019 eine Summer School für Promovierende, Studierende und Berufseinsteiger. Unter dem Titel Cultural Tourism and Digitization werden hauptsächlich Themen wie #Tourismus #Kultur #Digitalisierung und #Barock behandelt. Die geografische Lage und die Modernität des Standortes Deggendorf schaffen ein perfektes Umfeld für den Austausch von Ideen und bieten viel Raum, um sich zu engagieren, zu diskutieren und zu reflektieren: In welchen Formen werden digitale Technologien im Kulturtourismus angewendet? Welche Erfahrungen, Wünsche und Perspektiven haben die Kultureinrichtungen? Was könnte in der Zukunft besser gemacht werden? In der einwöchigen Summer School Cultural Tourism and Digitization haben die Teilnehmer*innen Gelegenheit, sich diesen und eigenen Fragen aus verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlichen Formaten zu nähern. Sie erhalten Einblicke in den Diskurs sowie in die Praxis aktueller Forschungsmethoden und werden von Expert*innen bei der Entwicklung eigener Projektideen unterstützt.
Die Summer School in Deggendorf richtet sich an Studierende und Doktoranden aller Fächer und Berufseinsteiger*innen. Studierende der THD erhalten im Optionalbereich 4 ECTS-Punkte. Bewerber*innen sollten einen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben an mariann.juha@th-deg.de senden. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2019. Die Kosten der Teilnahme (inkl. Reise- und Übernachtungskosten) werden von den Organisatoren übernommen.

Pilgern nach Rinchnach im Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“ vom Technologie Campus Freyung
Das am Technologie Campus Freyung durchgeführte Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“ ermöglicht Pilgern, Wanderern und geschichtlich Intersessierten die historische Kulturlandschaft entlang von grenzüberschreitenden Wegen im Bayerischen-Böhmischen Wald mit modernen und digitalen Medien zu entdecken.
Im Rahmen des Projektes entsteht ein digitaler und multimedialer Reiseführer, der den Tourismus der Grenzregion aufwerten soll. „Peregrinus Silva Bohemica“ ist ein gemeinsames Projekt der Westböhmischen Universität Pilsen, der gemeinnützigen Gesellschaft Uhlava und der Technischen Hochschule Deggendorf am Technologie Campus Freyung.
Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union Ziel ETZ Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2014 – 2020 (Interreg V) durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Im Rahmen einer zweitägigen Exkursion haben nun die tschechisch-deutschen Projektpartner Pilgerorte zwischen Klattau und Rinchnach aufgesucht. Ziel der Veranstaltung war es, die auf dem Weg liegenden Barockkirchen zu besichtigen und sich durch Fachreferate auszutauschen. Diese wurden dem Projekt entsprechend in der ehemaligen Klosterkirche in Rinchnach gehalten. Im Anschluss zeigte der Heimatpfleger aus Rinchnach, Herr Dingler, die nahe gelegene Kirche Frauenbrünnl und die Pfarrkirche "St. Johannes der Täufer" . Beide Kirchen sind Teile des Gunterweges und damit ein geeignetes Ziel für Pilger. „Die Kirche feiert dieses Jahr ihr 1000-jähriges Jubiläum mit vielen Kulturprogrammen“, erzählte Herr Dengler stolz und freut sich auf zahlreiche Besucher Die Exkursion der Projektpartner fand ihren abschließenden Höhepunkt in einem atemberaubenden Konzert in Barockstil, zu dem neben den Forschern auch Mitglieder vom Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen kame. Das Projekt zeigt, wie wichtig historisches Kulturgut ist und dass es aktuelle Medien das Interesse dafür wieder wecken kann.
Das Bild zeigt den Heimatpfleger Herrn Dengler aus Rinchnach, Frau Dr. Mariann Juha vom Technologie Campus Freyung und Herrn Kaplan Nischl mit dem Modell von der Kirche St. Johannes der Täufer in Rinchnach bei der Exkursion der Projektteilnehmer von Peregrinus Silva Bohemica.

Technologie Campus Freyung schaltet Projektwebseite online
Erneuerbare Energien sind einer der wichtigsten Bausteine in der Energiewende.
Dies haben auch die Akteure des grenzüberschreitenden EU-Projektes ENERGY BARGE (INTERREG Donauraum) erkannt,zu denen der Technologie Campus Freyung und 14 Partner aus sieben europäischen Ländern gehören. Gemeinsam arbeiten sie in dem Projekt für die stärkere Nutzung der Donau als Transportweg für Biomasse, die für die Erzeugung von Bioenergie genutzt werden kann.
Häfen entlang der Donau sollen darüber hinaus als Standorte für Bioenergieerzeugung optimiert werden. Zu den wichtigsten Produkten der Biomasse zählen unter anderem Holz, Pellets, Öle oder Getreide, welche speziell für den Energiesektor produziert werden. Die Donau verbindet zehn Länder, in denen Produzenten und Nutzer von Biomasse angesiedelt sind. Damit nun Roh- und Reststoffe, aber auch Zwischen- und Endprodukte für den Bioenergiemarkt aus einem Land in ein anderes Land gelangen können, ist die Donau ein kosten- und energieeffizienter Transportweg, der in Zukunft stärker genutzt werden kann.
„Die Donau bietet gerade für Massengüter wie Biomasse hohe Transportkapazitäten und vergleichsweise niedrige Transportkosten, und das auf energieeffiziente Weise. Wenn bei gleichem Energieverbrauch ein Schiff statt einem LKW genutzt wird, dann kann dieses Schiff vier mal so weit fahren wie ein LKW. Und wenn bei ca. 1000 t Ladung ein Schiff genutzt wird, ersetzt dies ca. 40 LKW auf der Straße“, fasst Ann-Kathrin Kaufmann von der Biocampus Straubing GmbH, einer Tochter des Hafens Straubing-Sand und Partner im Projekt, die Bedeutung des Donauweges zusammen.
Die erhöhte Nutzung der Donau soll dadurch erreicht werden, dass sich durch das Projekt Produzenten und Nutzer von Biomasse sowie die Häfen aus den Ländern entlang der Donau besser kennen und vernetzen können. Bisher gab es keine zentrale Stelle, bei der man sich über die Möglichkeiten, die die Donau speziell für den Transport von Biomasse bietet, informieren kann. Durch die Arbeit des Technologie Campus Freyung im Konsortium wird nun eine Lösung für dieses Problem präsentiert. Die Projektmitarbeiter haben eine Internet-Plattform entwickelt, die alle wichtigen Informationen zum Thema Biomasse-Transport und Logistik auf der Donau präsentiert. Firmen, Häfen und andere Akteure können sich dort kostenlos registrieren und alle für sie wichtigen Informationen finden. Die wichtigsten Akteure der gesamten Wertschöpfungskette für Biomasse sind auf der Internetseite zu finden und so hoffen die Projektmitarbeiter aus ganz Europa auf eine stärkere Zusammenarbeit.
Die Seite www.energy-barge.eu ist seit Anfang Oktober online und knapp 700 Firmen, Häfen und weitere Partner sind bereits vertreten. Auch für die interessierte Öffentlichkeit bietet die Seite umfangreiche Informationen und kann helfen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit Erneuerbarer Energien zu steigern.
Das Bild zeigt die Projektpartner von viadonau bei der Präsentation der Webseite bei einem Businessmeeting in Wien. (Quelle: viadonau / Johannes Zinner)

Der Bayerisch-Böhmische Grenzraum ist mit seinen weiten Naturflächen und den historischen Kulturstätten und Baudenkmälern eine reizvolle Region für das Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“. In dem Projekt geht es darum, diese Kulturgüter zu bewahren und in der modernen Zeit erlebbar zu machen. Dazu wird bis Ende September 2019 in dem Projekt, an dem der Technologie Campus Freyung beteiligt ist, eine App fürs Handy entwickelt. Die App präsentiert u.a. Wissenswertes zu den Denkmälern digital neu aufbereitet und anschaulich. Nun können diese historischen Schätze aber auch real erlebt werden.
Vom 08. Juli bis 30. August können die gedruckten 3D-Modelle der Kulturgüter im Landratsamt Deggendorf und zeitgleich vom 09. bis zum 30. Juli 2019 im Haus der Europaregion Donau-Moldau in Freyung besichtigt werden.
„Die Ausstellung zeigt, was heute technisch alles möglich ist, um historische Kultur zu bewahren und aufzuwerten. So präsentiert die Ausstellung Jahrhunderte alte Objekte als 3D-Modelle und sie zeigt, wie diese Modelle in die technischen Medien von heute eingebunden sind. Das ist mehr als spannend und sollte man gesehen haben“, fasst Dr. Mariann Juha, Projektleiterin am TC Freyung, die Bedeutung der Ausstellung zusammen. Die Technische Hochschule Deggendorf am Standort Freyung hat in den letzten knapp drei Jahren zusammen mit der Westböhmischen Universität Pilsen und der gemeinnützigen Gesellschaft Uhlava an diesem Projekt gearbeitet. Neben der App als Reiseführer und einem Buch rundet die Ausstellung nun die erzielten Ergebnisse ab. Nach ihrem Gastauftritt in Freyung wird die Ausstellung im Grenzraum wandern, bevor sie dann im Herbst in der Bayerischen Repräsentanz in Prag ankommen wird. Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union Ziel ETZ Freistaat Bayern –Tschechische Republik 2014 –2020 (Interreg V) durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

B4y3rw4ld Hackathon
vom 10.-11.11.2017 am Technologie Campus in Freyung

Im Rahmen der Gründerwoche steht unser erster 24-Stunden-Hackathon kurz bevor. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir Entwicklern, Gründern und Unternehmern die Möglichkeit bieten, Erfahrungen auszutauschen und zielgerichtet an der eigenen Businessidee sowie dem eigenen Start-up und Produkt zu arbeiten.
GLEICH ANMELDEN
Unter Angabe einer Kontaktperson (E-Mail und Telefon), Anzahl der Teilnehmer (mit Vor- und Nachname) eures Teams, Alter der Teilnehmer, Teamname und Hinweisen zu Technologien / technischem Know-how) an:
info.tc-freyung@th-deg.de
Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldeschluss ist der 01. November 2017.
Weitere Infos unter: https://www.mehralsduerwartest.de/

WilDa, ein Projekt für verbesserte Wildwarnungen zum Schutz von Verkehrsteilnehmern und Wildtieren - Bundesminister Dobrindt übergibt Förderbescheid am TC Freyung

Die Gefahr von Wildunfällen für Verkehrsteilnehmer zu reduzieren, ist das Ziel einer Forschungsgruppe am Technologie Campus (TC) Freyung. Mit dem Projekt WilDa greifen Experten der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) zusammen mit mehreren Kooperationspartnern aktuelle Entwicklungen aus der Geoinformatik und Informatik auf, die dabei helfen können, Wildunfälle in Zukunft besser vorzubeugen. Den offiziellen Startschuss für das Projekt gab Bundesminister Alexander Dobrindt am Donnerstag, 21. September. Insgesamt wird das Projekt vom BMVI mit 1,1 Millionen Euro gefördert.
Wildunfälle sind für Mensch und Tier ein großes Gefahrenpotential und lassen Politik, Verkehrs- und Straßenbaubehörden sowie die Jägerschaft nach besseren Schutzmaßnahmen streben. „Unser Ziel ist, eine verbesserte Grundlage für Wildwarnungen, zum Beispiel über mobile Geräte, und lokale Schutzmaßnahmen zu erarbeiten“, erklärt Prof. Dr. Wolfgang Dorner, Leiter des TC Freyung. Unter Federführung des TC Freyung beschäftigt sich eine interdisziplinäre Forschergruppe aus den Bereichen der Geoinformatik, Informatik, Wildtierökologie sowie der Unternehmensförderung im Projekt WilDa mit der Identifikation von Faktoren, die Wildunfälle beeinflussen. Verkehrs-, Unfall- und Umweltdaten werden dafür umfassend berücksichtigt. Die Erkenntnisse sollen den Verkehrsteilnehmern in einer dynamischen, das heißt orts- und zeitabhängigen Wildunfallwarnung zur Verfügung gestellt werden.
Gefördert wird das Projekt „WilDa - Dynamische Wildunfallwarnung unter Verwendung heterogener Verkehrs-, Unfall- und Umweltdaten sowie Big Data Ansätze“ durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Über das Förderprogramm mFUND werden insgesamt 1,1 Mio. Euro für die Forschungsarbeiten zur Verfügung gestellt. Den Startschuss für das Projekt gab Bundesminister Alexander Dobrindt am 21. September am Technologie Campus Freyung. Er überreichte einen Förderbescheid in Höhe von 875.000 Euro an die Projektverantwortlichen der THD und in Höhe von 230.000 Euro an die Universität Freiburg.

Inspiriert wurde das Projekt durch wuidi, ein StartUp, das eine erste mobile Anwendung entwickelt, die Autofahrer vor einer erhöhten Wildunfallgefahr warnt und bei der Abwicklung von Wildunfällen unterstützt. Weiter unterstützen Partner wie die Bayerische Polizei und das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, der Nationalpark Bayerischer Wald, der Jagdverband und der ADAC das Vorhaben durch die Bereitstellung von Daten und Know-how.

Ein Netzwerk für den Klimaschutz

Kommunale Klimaschutz-Verantwortliche treffen sich in Freyung
Das Thema Klimaschutz nimmt in den Kommunen einen immer höheren Stellenwert ein. Verständlich, da noch mehr Engagement gefordert ist, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung noch zu erreichen. "Nur wenn wir noch mächtig zulegen, können wir die Folgen des Klimawandels noch maßgebend abschwächen", sagt Verena Bauer, Klimaschutzmanagerin des Landkreises.
In den Landkreisen Freyung-Grafenau, Passau und Regen passiere allerdings schon sehr viel. Zum Austausch über erfolgreiche Projekte und Problemstellungen des kommunalen Klimaschutzes sind neun Klimaschutzmanager in Freyung zusammengekommen.
Ein erstes Treffen im kleineren Rahmen hatte bereits im Juli in Regen stattgefunden. Dabei entdeckten die Teilnehmer, wie wertvoll der Austausch in diesem Bereich ist. Daraufhin organisierte FRG-Klimaschutzmanagerin Verena Bauer das nächste Treffen in Freyung, dieses Mal in größerer Runde. "Je-der arbeitet an ähnlichen Projekten, da ist es sehr hilfreich, wenn man bei Kollegen aus an-deren Kommunen nachfragen kann, wie es da gelaufen ist.", erklärt Bauer.
Nach der Begrüßung durch Sachgebietsleiter Reinhard Tolksdorf folgte die Netzwerk- und Austauschrunde der Teilnehmer. Die Themen reichten von Heizungstechnik über Photovoltaik bis LED-Technik in der Straßenbeleuchtung. Viel diskutiert wurde auch darüber, wie man die Bevölkerung für das Thema Klimaschutz nachhaltig sensibilisieren kann und wie erfreulich es doch sei, dass man Kinder dafür umso mehr begeistern kann.
Für einen Fachvortrag hatteBauer zudem Prof. Dr. Roland Zink als Gastrednerngeladen, welcher zum Thema "Ist das Klima schon gerettet? Zur Notwendigkeit des Klimaschutzes auf kommunaler Ebene" referierte. "Die politischen Weichen für die Energiewende sind gestellt, aber zur Umsetzung sind jetzt die Kommunen gefragt", betonte Zink in seinem Vortrag. Energiewirtschaft, Gebäude und Verkehr stellen dabei die kommunalen Hauptaspekte dar. Lösungsansatz dafür könnten etwa lokale Zusammenschlüsse von Photovoltaik-Anlagen sein.
Mit einem Algorithmus des Technologiecampus Freyung könnten beispielsweise in einem Dorf genau die Dächer ermittelt werden, die zu einer Glättung der PV-Ertragskurve führen und so wirtschaftlich und einfach den Gebäudezusammenschluss mit regenerativen Strom versorgen.
"Der Austausch ist sehr wichtig, mit Treffen wie diesen lernt man einander kennen, vergrößert sein Netzwerk und alle Seiten profitieren davon", sagt Verena Bauer. Weitere Netzwerktreffen sollen folgen, das nächste ist für Anfang nächsten Jahres in Hauzenberg geplant.
(PNP)

Bionik & Innovationsmanagement - Praxisworkshop
am 23.01.2018 in Linz
Der Erfolg eines Unternehmens hängt oft vom Innovationspotenzial ab und somit vor allem auch von der Fähigkeit neue Ideen für Produkte und Prozesse zu generieren. Eine Vielzahl von Kreativitätsmethoden können bei diesem Prozess unterstützen.
Erleben Sie in unserem Praxisworkshop die Bionik als neue Kreativitätstechnik und daher als neuartige Inspirationsquelle. Eröffnen Sie sich außergewöhnliche Lösungsansätze durch Vorbilder aus der Natur. Lernen Sie verschiedene Methoden und Tools kennen und praktisch anwenden.
Veranstaltungsort:
Ö. Imkereizentrum - OÖ Landesverband für Bienenzucht
Pachmayrstr. 57, 4040 Linz
Veranstaltungsdatum
23.01.2018 von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Weitere Infos unter:

Bionik & Innovationsmanagement
am 01.02.2018 in Salzburg
Der Erfolg eines Unternehmens hängt oft vom Innovationspotenzialab und somit vor alle m auch von der Fähigkeit, neue Ideen für Produkte und Prozesse zu generieren. Eine Vielzahl von Kreativitätsmethoden können bei diesem Prozess unterstützen.
m auch von der Fähigkeit, neue Ideen für Produkte und Prozesse zu generieren. Eine Vielzahl von Kreativitätsmethoden können bei diesem Prozess unterstützen.
Erleben Sie in unserem Praxisworkshop die Bionik als neue Kreativitätstechnik und daher als neuartige Inspirationsquelle. Eröffnen Sie sich außergewöhnliche Lösungsansätze durch Vorbilder aus der Natur. Lernen Sie verschiedene Methoden und Werkzeuge kennen und praktiwsch anwenden.
Veranstaltungsort:
WIFI Salzburg
Julius-Raab-Platz 2, 5020 Salzburg
Veranstaltungsdatum:
01. Februar 2018, 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes "ILBitZ-Innovative Lösungen mit Bionik im transnationalen Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft" statt. Das Projekt wird durch Mittel der EU aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Programm INTERREG Österreich - Bayern 2014 - 2020 gefördert.
Weitere Information:
https://www.itg-salzburg.at/media/veranstaltungen/1802/Flyer_Innovationsmanagement_v03.1-min.pdf

Neue App gibt Informationen für Reisende und Einheimische in der Grenzregion Bayern-Tschechien
Die am Technologie Campus Freyung ansässigen Entwickler und Geoinformatiker arbeiten derzeit an einer Handy-App, die für Touristen, Pilger, aber auch Einheimische im bayerisch-tschechischen Grenzraum interessant sein könnte. Ob unterstützend zur Reiseplanung oder zum individuellen Abrufen von Informationen vor Ort, ist die App eine neue Möglichkeit, das Kulturgut in der Region zwischen Bayern und Tschechien zu erkunden. Nach der ersten Konzeptphase beginnt die Freyunger Arbeitsgruppe jetzt mit der praktischen Umsetzung.
Ob unterstützend zur Reiseplanung oder zum individuellen Abrufen von Informationen vor Ort, ist die App eine neue Möglichkeit, das Kulturgut in der Region zwischen Bayern und Tschechien zu erkunden. Nach der ersten Konzeptphase beginnt die Freyunger Arbeitsgruppe jetzt mit der praktischen Umsetzung.
Wie so oft entstehen die besten Ideen, wenn man nicht unmittelbar damit rechnet. Während einer Dienstreise durch den Bayerischen Wald sind den Wissenschaftlern des Technologie Campus Freyung beeindruckende Barock-Bauwerke aufgefallen. Oft sehr exponiert, manchmal etwas versteckt im Wald, aber selbst für Einheimische nicht unbedingt bekannt. Sie stellten sich die Frage, wie zum Beispiel bei einem Ausflug vor Ort Informationen über solche Bauwerke abgerufen werden können, ohne dabei umständlich über das Internet oder Suchmaschinen recherchieren zu müssen.
Mit dem bayerisch-tschechischen Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“ ist das Team am Technologie Campus Freyung genau dieser Frage nachgegangen. Über einen multimedialen Kultur- und Reiseführer, der in dem Projekt entwickelt wird, erfolgt die Visualisierung von Sehenswürdigkeiten der Region in Form einer App für Smartphones und Tablets. Foto- und Filmmaterial, eigens konstruierte 3D-Darstellungen und Audio-Guides werden zum Einsatz kommen, um den Nutzer umfassend über die Kulturgüter der Region zu informieren. Auch die Entwicklung hilfreicher Zusatzfunktionen der App ist Teil des Projekts. Zum Beispiel können vordefinierte Routen für die Navigation genutzt und Informationen zu Sehenswürdigkeiten auf den Routen abgerufen werden. Daneben ist eine individuelle Reiseplanung mittels interaktiver Karte möglich. Die Fortbewegungsart (Fahrzeug, Fußweg) kann dabei vom Nutzer der App ausgewählt werden. Damit all die Funktionen später wie beschrieben einsetzbar sind, ist das Know-How der Entwickler und Geoinformatiker in Freyung gefragt.
Auftakt für die Foto- und Videoaufnahmen, die zur Programmierung der App notwendig sind, war kürzlich mit Unterstützung der Agentur bildschnitt TV in Neukirchen beim Heiligen Blut. Die App wird voraussichtlich ab Herbst 2019 kostenlos unter dem Namen „Peregrinus“ zum Download verfügbar sein. Bereits jetzt werden Tourismusverbände und Studierende an der Gestaltung beteiligt.
Über das Projekt:
Das Projekt „Peregrinus Silva Bohemica“ ist ein gemeinsames Projekt der Westböhmischen Universität Pilsen, der gemeinnützigen Gesellschaft Uhlava und der Technischen Hochschule Deggendorf. Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union Ziel ETZ Freistaat Bayern – Tschechische Republik 2014 – 2020 (Interreg V) durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Das Projekt wird von der Arbeitsgruppe Geoinformatik des Technologie Campus Freyung präsentiert. Das Team beschäftigt sich damit, wie digitale Medien und geographische Information verknüpft werden können. Zu verschiedenen Projekten und Inhalten (partizipative Raumplanung, Rekonstruktion von Kulturgütern) werden Konzepte für interaktive Kartendienste und raumbezogene Visualisierung entwickelt.
Bild: bildschnitt TV bei den ersten Filmaufnahmen für die Reise-App „Peregrinus“ in der Wallfahrtskirche in Neukirchen, Copyrigt: Johanna Trager, Technologie Campus Freyung 2018

Praxisworkshop am 12.07.2018 im Tiergarten Linz
 Logistische Herausforderungen gibt es im privaten wie beruflichen Umfeld. Und insbesondere in Zeiten intelligenter Produktion werden diese immer anspruchsvoller. Die Natur hat für solche Herausforderungen Lösungen entwickelt, von denen Unternehmen lernen können, um ihre Produktivität zu steigern.
Logistische Herausforderungen gibt es im privaten wie beruflichen Umfeld. Und insbesondere in Zeiten intelligenter Produktion werden diese immer anspruchsvoller. Die Natur hat für solche Herausforderungen Lösungen entwickelt, von denen Unternehmen lernen können, um ihre Produktivität zu steigern.
Lernen Sie in unserem Praxisworkshop biologisch inspirierte Verfahren kennen und erfahren Sie, wie sich logistische Herausforderungen meistern lassen.
Veranstaltungsort:
Tiergarten Linz - Seminarraum
Windflachweg 1, 4040 Linz
Veranstaltungsdatum
12.07.2018 von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Weitere Infos und Anmeldung unter: Zu den Informationen

 BIONISCHE MATERIALIEN: VON DER NATUR INSPIRIERT
BIONISCHE MATERIALIEN: VON DER NATUR INSPIRIERT
Zusammen mit der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e. V. Würzburg (IJF) hatte die Technische Hochschule Deggendorf wieder einmal zu einer Lehrerfortbildung eingeladen. Diesmal zum Thema „Bionische Materialien - von der Natur inspiriert". Die THD ist Stützpunkt der IJF in Ostbayern und führt seit längerem erfolgreich sog. Bionik-Schulbesuche durch, die der IJF konzipiert hat.
Beim Thema Bionik denken die meisten Menschen an Geckofüße, die an Wänden haften oder an den Lotuseffekt, der saubere Oberflächen verschafft. Doch die Bionik umspannt ein weites Feld und ist sehr interdisziplinär. „Was lernen wir von Schmetterlingen?" fragte beispielsweise Kirsten Wommer von der Bionik-Arbeitsgruppe am THD-Technologiecampus Freyung. Der Aufbau der Flügeloberfläche beim Schmetterling ist derart, dass uns dessen Struktur bestimmte Farben sehen lässt. Aufschlussreich ist ferner die Sensorik an den Fühlern. Die Bionik schaut sich Lösungskonzepte der Natur an und setzt diese bei technischen Fragestellungen ein. Es braucht viel Kreativität, um die in der Natur entstandenen Lösungen zu übertragen.
Wie fördert man Kreativität, insbesondere bei Kindern? Wann kommen die Grenzen in die Köpfe, die das Finden neuer Lösungswege blockieren? Sehr anschaulich konnten die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer das bedenkenlose Nachgehen ausgetretener Pfade durch kleine Kreativübungen im Vortrag erleben und ihre eigenen Blockaden entdecken.
Ebenfalls hautnah erleben konnten die Teilnehmer zahlreiche Bionik-Versuche, die im Praxisteil der Fortbildung auf dem Programm standen. Hier war Probieren und Machen erlaubt. Dabei unterliefen den Lehrern sympathischer Weise dieselben „klassischen" Fehler wie Schülerinnen und Schülern während der Experimente bei den Bionik-Schulbesuchen.
Als ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung erwies sich der spannend gestaltete Vortrag von Dr. Daniel Van Opdenbosch vom Wissenschaftszentrum Straubing, Fachgebiet Biogene Polymere der TU München. Er entführte in die Mikro- und Nanostrukturen von Käferflügeldecken und Perlmuttschichten von Muscheln. Einleuchtend und nachvollziehbar erklärte er seinen Zuhörern, wie die Forschung herausgefunden hat, warum der Aufbau dieser Strukturen genauso sein muss, wie er ist, um optimal funktionieren zu können, und wie es möglich wird, manche biologischen Strukturen exakt nach dem Vorbild der Natur nachzubauen.
Eine Führung in verschiedene Labore der TH Deggendorf rundete das Programm ab. Im Wasserbaulabor von Prof. Rudolf Metzka erläuterte Werkmeister Georg Hofinger die Wasserströmungen im Uferbereich von Flüssen und wie diese mit baulichen Maßnahmen gezielt beeinflusst werden können. In den Laboren der Fakultät Maschinenbau begrüßte Prof. Dr. Martin Aust die Besucher und stellte verschiedene Möglichkeiten der Materialprüfung und die dazu nötigen Maschinen vor; u.a. gab er einen Einblick in die Elektronenmikroskopie.
Foto 1: Bionik-Experimente: Die Lehrerinnen und Lehrer beim Werkeln und Ausprobieren.
FOTO 2: Werkmeister Georg Hofinger (3. v. r.) präsentierte die Arbeit im THD-Wasserbaulabor.

 Grenzüberschreitendes Projekt schafft Kooperationsplattform für Wirtschaft und Wissenschaft
Grenzüberschreitendes Projekt schafft Kooperationsplattform für Wirtschaft und Wissenschaft
Am Technologie Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) wird in den nächsten drei Jahren grenzüberschreitend eine Bionik-Kooperationsplattform auf- und ausgebaut. Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts sollen die Bionik-Kompetenzen der beteiligten Regionen zusammenführt werden.
Im September fiel der Startschuss für das drei Jahre dauernde Projekt, das in Freyung koordiniert und zusammen mit der Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (Biz-Up), der ITG – Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH (ITG) und der Fachhochschule Salzburg GmbH durchgeführt wird. „Bionik fasziniert leicht, doch für eine erfolgreiche praktische Umsetzung benötigen Unternehmer und Entwickler ein vertieftes Wissen. Dieses wollen wir durch die enge Vernetzung von Forschungseinrichtungen und Unternehmen mit dem Projekt ILBitZ erreichen“, so Kirsten Wommer, Projektleiterin am TC Freyung. ILBitZ steht für „Innovative Lösungen durch Bionik im transnationalen Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft“ und hat zum Ziel, die praktische Anwendung von Bionik in Unternehmen zu fördern. Durch eine geschaffene Kooperationsplattform sollen Unternehmen unterstützt werden, innovative Lösungen zu finden und Bionik als Problemlösungsstrategie einzusetzen. Insbesondere auch kleine und mittlere Unternehmen sollen Bionik als Innovationsstrategie für den globalen Wettbewerb kennenlernen und die Bionik-Anwendung im Unternehmen soll forciert werden. Durch die Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft soll der praxisnahe Wissenstransfer gefördert werden, der zu innovativen Anwendungen in Unternehmen führen soll. „Gemeinsam mit unseren Projektpartnern werden wir praxisnahe Veranstaltungen und Maßnahmen anbieten, die Unternehmen helfen, mit Bionik zu innovativen Lösungsansätzen zu gelangen“, beschreibt Kirsten Wommer die Ziele von ILBitZ. ILBitZ ist die Fortführung des bis 2015 durchgeführten Projektes „ImB – Innovativ mit Bionik!“, bei dem die Projektpartner THD, Biz-Up und ITG bereits zusammengearbeitet haben. Nun soll an diese Erfolge angeknüpft werden und mit der Fachhochschule Salzburg GmbH ist ein weiterer Hochschulpartner aus Österreich dazugekommen.
Das Projekt wird in dem Programm INTERREG V-A gefördert, welches auf die intensive Zusammenarbeit von Österreich und Bayern abzielt. „Durch diese Interreg-Förderung wird die unternehmerische und wissenschaftliche Zusammenarbeit von Niederbayern und Österreich intensiviert. Sie ermöglicht uns, Forschung und Entwicklung in unseren Betrieben – mit einem starken Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen - zu fördern und den grenzüberschreitenden Raum als Bionik-Region zu stärken", so Rainer Steindler von der ITG Salzburg.

MobiCare LBS heißt das Projekt, das in den vergangenen Monaten Wissenschaftler am Technologie Campus Freyung beschäftigt hat. Wie können Pflegekräfte auf dem Smartphone oder zukünftig mit  intelligenten Brillen unterstützt werden, war die Hauptfrage des Projekts. Die Forschungsarbeit wurde im April belohnt und vom Medical Valley EMN, dem Bayerischen Netzwerk für Medizintechnik, mit dem ersten Preis in der Kategorie Digitales Krankenhaus ausgezeichnet.
intelligenten Brillen unterstützt werden, war die Hauptfrage des Projekts. Die Forschungsarbeit wurde im April belohnt und vom Medical Valley EMN, dem Bayerischen Netzwerk für Medizintechnik, mit dem ersten Preis in der Kategorie Digitales Krankenhaus ausgezeichnet.
„MobiCare LBS“ steht für „Intelligentes mobiles Assistenzsystem für die Pflege mithilfe von Location Based Services“. Seit 2016 arbeitet die neue Forschungsgruppe „Digitale Pflegetechnologien“ am Technologie Campus in Freyung an neuen Lösungen für die ambulante und stationäre Pflege. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung von Software für sogenannte Smart Devices, also Smartphones, Uhren oder Brillen. Hierzu wurde seit Oktober am Technologie Campus Freyung eine neue Forschungsgruppe aufgebaut, die die Kompetenzen der Technischen Hochschule Deggendorf in Pflege und Informatik zusammenführt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Dorner (Angewandte Informatik) und Prof. Dr. Christian Rester (Pflegewissenschaft) entwickelt das Forschungsteam in Zusammenarbeit mit IQ.medworks GmbH (eHealth, Telemedizin) und gLOC (Last-Mile-Navigation) ein mobiles Assistenzsystem, das Pflegekräfte bei der Basis- und Intensivpflege unterstützt. „Wir wollten dabei nicht ein System entwickeln, das Patientendaten nun auf dem Smartphone statt auf dem PC verwaltet. Das wäre nichts Neues gewesen.“, erklärt Prof. Dr. Wolfgang Dorner. „MobiCare LBS ist eine Software, die die Pflegekraft durch den Arbeitsalltag leitet und navigiert und immer dann besonders aktiv wird, wenn der Pfleger in eine neue Situation kommt.“ Die Anwendung soll also zum Beispiel unterstützen, wenn es Änderungen im Arbeitsalltag gibt. Prof. Dr. Christian Rester kennt diese Situationen: „Pflegekräfte sollen sich doch eigentlich auf die Patienten konzentrieren. Häufig wird der Alltag aber von Kleinigkeiten bestimmt. Vor allem, wenn man in der ambulanten Pflege kurzfristig einen neuen Patienten übernehmen muss. Wie finde ich da hin? Wo wohnt er genau? Was brauche ich da alles? Das sind dann die kleinen Probleme, die einen abhalten sich um die Menschen zu kümmern.“ Auch die Vielfalt und Komplexität technischer Geräte und Prozessabläufe nimmt immer weiter zu und führt im Alltag oftmals zu Stress sowie Überforderung des Personals. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, entstehen im Rahmen des Forschungsprojektes MobiCare LBS neue Ansätze, welche die Pflegekräfte von der Anfahrt zum Patienten bis hin zu telemedizinischer Hilfe bei der Gerätebedienung und multimedialer Pflegedokumentation unterstützen. Das System soll den Pflegealltag erleichtern und somit die Behandlungsqualität steigern.
Im Rahmen des Innovationspakts der Europäischen Metropolregion Nürnberg hatten die Kompetenzinitiativen Medical Valley EMN, ENERGIEregion Nürnberg und Neue Materialien (KINEMA) ab September 2016 den Open-Innovation-Wettbewerb zum Thema „Krankenhaus der Zukunft“ ausgerufen. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Prof. Dr. Clemens Bulitta (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden), Adalbert Meiszburger (Service Gesellschaft Sozialstiftung Bamberg mbH), Dr. Marcus Rauch (Cluster Neue Materialien, Bayern Innovativ GmbH) und Richard Weller (CBRE PREUSS VALTEQ GmbH), hat im April die Gewinner des Ideenwettbewerbs gekürt. Von den rund 50 eingereichten Ideen und teilweise bereits in der Anwendung befindlichen Konzepten und Produkten hat der Technologie Campus Freyung mit seinem Beitrag überzeugt und wurde mit dem ersten Preis belohnt.
Die erste Lösung, die aktuell im Test ist, ist auf Smartphones fokussiert. „Die meisten Pfleger haben so ein Gerät in der Tasche. Das bietet sich an. Was für uns aber hochgradig spannend wird, ist die Entwicklung für andere Geräte, wie Armbänder, Uhren oder Datenbrillen. Da steckt viel Potential drin.“, schwärmt Anne Weinfurtner, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Informatikerin am Technologie Campus Freyung von den nächsten Arbeitsschritten.

Auftakt des ersten Chile-Projektes am Technologie Campus Freyung

INCREASE bedeutet steigern und dies möchten auch die Partner des gleichnamigen Projektes erreichen, das nun am Technologie Campus Freyung gestartet ist. Steigern soll sich die Nutzung erneuerbarer Energien in Chile. Mit dem Wachstum erneuerbarer Energien ist in Chile auch gleichzeitig die Hoffnung verbunden, dass das Energienetz dadurch stabiler und zuverlässiger wird. Deshalb haben sich Experten des Technologie Campus Freyung, der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sowie der Päpstlichen Katholischen Universität Val Paraiso im Projekt INCREASE zusammengeschlossen.
Für die chilenische Regierung werden Ansätze entwickelt, wie der Anteil erneuerbarer Energien, insbesondere Solarenergie, gesteigert werden kann. Die Freyunger Wissenschaftler steuern dazu ihre langjährige Expertise in der Modellierung von Energiesystemen sowie Simulationsmodelle für Erneuerbare Energien bei und werden diese auf die Situation in Chile anpassen.
Zum Auftakt des Projektes ist Luis Ramirez Camargo Anfang April zu den Kollegen nach Chile gereist, um im Rahmen von Technologie-Workshops mit Vertretern unterschiedlicher Interessensgruppen, Ministerien und Unternehmen Daten zu sammeln und den Ablauf des Projektes abzustimmen. Zwei Wochen war der gebürtige Kolumbianer, Wahlbayer und Wissenschaftler am Freyunger Campus der Technischen Hochschule Deggendorf in Santiago und Val Paraiso. Wichtige Termine fanden mit dem Direktorium der Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Chilenische Agentur für Energieeffizienz) sowie Abteilungsleitern des Chilenischen Energieministeriums statt.
INCREASE steht für "INCREASing renewable Energy penetration in industrial production and grid integration through optimized CHP energy dispatch scheduling and demand side management". So lautet der vollständige Titel des Projektes, das durch das Bundsministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms "Wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit mit Chile" und das Chilenische Wissenschaftsministerium unterstützt wird. Im Sommer werden Kollegen aus Chile für zwei Wochen am Technologie Campus in Freyung zu Gast sein, um mehr über Modelle zur Simulation von Energiesystemen zu erfahren.
Bild (Luis Ramirez/TC Freyung): Matthias Grandel und Cecilia Figeroa, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (4. und 5. v.l.), Prof. Dr. Yunesky Masip Macia (6. v.l.), Päpstliche Katholische Universität Valparaíso, Luis Ramirez vom Technologie Campus Freyung sowie Vertreter der Geschäftsführung der ACENOR- Asociación de consumidores de energía no regulados (Verband der nicht-regulierten Stromverbraucher)

Grenzübergreifende Stärkung von Forschung und Innovation:
Der Technologie Campus Freyung der TH Deggendorf setzt mehrere zukunftsw eisende INTERREG-Projekte gemeinsam mit seinen tschechischen Partnern in Budweis, Klattau und Pilsen um.
eisende INTERREG-Projekte gemeinsam mit seinen tschechischen Partnern in Budweis, Klattau und Pilsen um.
Wissenschaftsstaatssekretär Bernd Sibler besuchte den Technologie Campus (TC) Freyung der Technischen Hochschule (TH) Deggendorf und informierte sich vor Ort über die grenzübergreifenden Projekte „BarkBeeDet: Drohnenbasierte Früherkennung von Bäumen mit Borkenkäferbefall“, „Peregrinus Silva Bohemica – Multimediale und digitale Touristenführung auf grenzüberschreitenden historischen Wegen im Bayer- und Böhmerwald“ und „PhotoStruk – Analyse historischer PHOTOgraphien für die virtuelle ReconSTRUKtion von Kulturgütern in der Bayerisch-Böhmischen Grenzregion“. Wissenschaftsstaatssekretär Bernd Sibler betonte: „Das gute nachbarschaftliche Verhältnis zwischen Bayern und Tschechien gründet auf vielfältigen Verbindungen. Neben Kunst und Kultur bieten besonders Wissenschaft und Forschung Anknüpfungspunkte, um die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit weiter auszubauen. Im Rahmen der grenzübergreifenden INTERREG-Projekte arbeiten unsere Wissenschaftler gemeinsam an wichtigen Zukunftsthemen. Damit stärken sie die engen Partnerschaften im bayerischtschechischen Grenzgebiet und füllen den europäischen Gedanken mit Leben!"

Bayerisch-Tschechische Projektpartnerschaften
Der TC Freyung setzt die Projekte gemeinsam mit seinen tschechischen Partnern in Budweis, Klattau und Pilsen im Rahmen des EU-Programms „INTERREG V-A – Bayern – Tschechische Republik“ um. Ziel des grenzübergreifenden Förderprogramms „INTERREG V-A“ ist es, die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien in der gemeinsamen Grenzregion nachhaltig zu entwickeln. Es ist Teil der Europäischen Kohäsionspolitik und soll die „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ voranbringen. Die EU unterstützt hierfür u. a. Maßnahmen zur Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation. Das Bayerische Wissenschaftsministerium begleitet die EU-Förderinitiative als Fachressort.

 Zwei neue Forschungsprofessuren - Mehr Zeit für Forschung
Zwei neue Forschungsprofessuren - Mehr Zeit für Forschung
Anfang Mai 2016 fand an der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) die diesjährige Forschungskonferenz statt. Dabei wurde ein Rückblick über die zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten im Bereich Forschung an der THD und ihren Forschungscampi im vergangenen Jahr gegeben. Hervorzuheben ist, dass 2015 rund zehn Millionen Euro in den Bereich Forschung & Entwicklung geflossen sind.
In Anerkennung ihrer Forschungsleistungen wurde Herrn Prof. Dr.-Ing. Günther Benstetter und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Dorner eine bis zum Sommersemester 2020 befristete Forschungsprofessur übertragen. Diese sieht ein um neun Semesterwochenstunden reduziertes Lehrdeputat vor. Herr Prof. Dr.-Ing. Günther Benstetter, seit 1998 Professor an der Fakultät Elektrotechnik, Medientechnik und Informatik, ist Leiter der Forschungsgruppe Mikro- und Nanoanalytik. Prof. Dr. Wolfgang Dorner, seit 2009 an derselben Fakultät tätig und seit 2010 wissenschaftlicher Leiter des Technologie Campus Freyung, ist spezialisiert auf Geoinformatik und Geoinformationssysteme sowie Umweltinformatik und Umweltinformationssysteme.
Abgerundet wurde die Konferenz mit einem gegenseitigen Ideenaustausch der verschiedenen Forschungsschwerpunkte, der zum Ziel hatte, Synergien zu bilden.
Bildunterschrift
Verleihung der Urkunden für die Forschungsprofessuren an Herrn Prof. Dr. Wolfgang Dorner (Mitte) und Herrn Prof. Dr.-Ing. Günther Benstetter (rechts) in Anerkennung ihrer hervorragenden Forschungsleistungen durch den Vizepräsidenten für Forschung und Wissenstransfer Herrn Prof. Dr.-Ing. Andreas Grzemba (links).
15.05.2016 | Deggendorf

 Vorschläge für die Zukunft der Heimatstadt wurden im Projekt „FreYoung“ erarbeitet und nun vorgestellt
Vorschläge für die Zukunft der Heimatstadt wurden im Projekt „FreYoung“ erarbeitet und nun vorgestellt
Freyung. Es war eine Wahnsinns-Arbeit, die sich an die 100 Schüler von vier Freyunger Schulen im vergangenen halben Jahr gemacht haben. Wie sie sich ihre Heimatstadt in der Zukunft wünschen − das haben sie nicht einfach nur zusammengetragen, sondern im Rahmen des Projekts „FreYoung“ an fünf ganz konkreten Beispielen gleich bis ins Detail geplant, Zeitpläne erarbeitet und sogar überdimensionale Modelle von einem Freizeitgelände am Geyersberg und in der Au gebaut. Und das hätte wohl auch ein Profi-Landschaftsplaner kaum besser hinbekommen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden nun im Stadtrat vorgestellt und ernteten entsprechend große Begeisterung.
Wie berichtet hat sich Freyung unter Federführung von Konversionsmanager Raimund Pauli und dem Projektpartner Technologie Campus mit Prof. Roland Zink beim deutschlandweiten Wettbewerb „Zukunftsstadt“ beworben und hier bereits die ersten Hürden genommen − als eine von vier Städten in Bayern steht Freyung bei dem Wettbewerb vor der nächsten Runde. Geht es weiter, winken 200 000 Euro vom Bildungsministerium, die dann auch für die Umsetzung der Schülerideen verwendet werden könnten.
Dem Stadtrat stellten die Schüler aus fünf Gruppen von der Mittelschule, Realschule, des Gymnasiums und des Beruflichen Fortbildungszentrums (BFZ) nun ihre Ideen vor. Genauer untersucht hatten sie dabei den Busbahnhof, die Situation im Öffentlichen Nahverkehr im Allgemeinen, den öffentlichen Raum in der Stadt, die Situation am Geyersberg und ein Veranstaltungskonzept für die Stadt.
Dass die Anregungen der Schüler durchaus eine Chance auf Verwirklichung haben werden, das war aus den Reaktionen der Stadträte schon jetzt herauszuhören. Auch wenn bei dieser Sitzung noch keine Entscheidung zu treffen war, so werde man eine Bewerbung für den Start in die zweite Bewerbungsrunde beim Wettbewerb „Zukunftsstadt“ in jedem Fall unterstützen, versicherte Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich schon mal. Er lobte die „Kreativität und die Verbundenheit zur Heimat“ der Schüler. Noch stehen die Richtlinien für die nächste Runde des Wettbewerbs nicht fest, aber sobald diese da seien, werde man einen Schwerpunkt aus den Schülervorschlägen auswählen und die Bewerbung abgeben. Zu den inmitten des Gremiums aufgestellten Modellen, die die Schüler gebaut hatten, meinte Heinrich: „So etwas haben wir in dieser Form noch nie gehabt.“ Beeindruckt zeigte er sich auch, dass sich für das Projekt gleich zu Beginn über 1000 Schüler interessiert hatten und rund 100 sich damit über Wochen hinweg intensiv beschäftigten.
Was die Vorschläge der Schüler angeht, so ging das Projekt Busbahnhof mit dem ohnehin bereits beschlossenen Neubau in der Bahnhofstraße durchaus Hand in Hand; und zwar nicht nur was die Analyse der aktuellen maroden Einrichtung betrifft, sondern auch was die Wünsche an den Neubau bzw. Ausstattung angeht − insofern also auch ein guter Gradmesser für die von Stadtrat bereits in Auftrag gegebene Neugestaltung, die ja bereits im Sommer beginnen soll.
Ähnliches gilt für die Situation des ÖPNV, mit der sich die Schüler ebenfalls beschäftigten: Modernisierung der Haltestellen, überfüllte Schulbusse, fehlende Pünktlichkeit haben die Schüler nicht nur festgestellt, sondern dazu wie bei allen Themen auch Lösungsvorschläge, Ansprechpartner und Zeitpläne präsentiert.
Was den öffentlichen Raum angeht, so gab es vor allem für den Auenpark, den die Schüler einfach zu langweilig fanden, einige Vorschläge. Also wie wär‘s hier mit Spielgeräten für Kinder, mit einem Spielfeld für Fußball oder Volleyball, mit Kunstwerken, schöneren Sitzgelegenheiten, einer Langlaufloipe im Winter oder Getränkeautomaten? Die Vorschläge der Schüler von der Realschule und dem bfz zu diesem Thema kamen an.
Der Geyersberg bräuchte in den Augen der Schüler nicht nur u.a. schönere Fassaden beim Ferienpark und eine bessere Verkehrsanbindung, sondern auch ein optimiertes Marketing, schönere Straßen und den Ausbau zu einem Freizeitschwerpunkt mit Vorschlägen wie Snowlooping, Flying Fox, Glühwein, Grillen, Lagerfeuer und Biergarten.
Und dann war da noch das Veranstaltungskonzept, mit dem sich im Projektteam die Realschule, das Gymnasium und das bfz gemeinsam beschäftigt hatten: Hier wurde ein Jugend-Open-Air vorgeschlagen und schon ganz konkret geplant: für Sommer 2017, mit Beteiligung behinderter Menschen, Bands aus der Region und einem DJ im Zelt. Sogar Logos für so eine Veranstaltung hatten die Schüler bereits entworfen.
Die Präsentation bildete damit den Abschluss dieser Phase im Wettbewerb, wo mit Jugendlichen der öffentlicher Stadtraum der Zukunft gestaltet werden sollte. Gekostet hat der Aufwand die Stadt Freyung erstmal nichts, denn das Projekt wurde von Juli 2015 bis März 2016 mit einer Förderquote von 100 Prozent vom Bundesbildungsministerium unterstützt.
Die Schüler hatten in Impulsveranstaltungen an jeder beteiligten Bildungseinrichtungen in den Jahrgängen 7 bis 10/11 zunächst Stärken und Schwächen bestimmt, die Hauptthemen festgelegt, und sich im konstituierenden Treffen kennengelernt. Um alle einzubinden, startete man u.a. auch eine Online-Umfrage.
Den aufwändigen Modellbau nahmen acht Schülerinnen und Schüler des bfz und fünf des Gymnasiums Freyung in Angriff. Zwei der geplanten Projekte wollte man maßstabsgetreu nachbauen, um so an einem größeren Modell (ca. 1,5 m auf 1,5 m) vom Geyersberg und der Au die Höhenstrukturen, Straßenverläufe und Gebäude besser sehen zu können. Dieser „3-D-Modellbau“ am Gymnasium Freyung war von Franz Häuslmeier vorbereitet worden.
Sie haben die Projekte im Stadtrat vorgestellt: Gruppe Busbahnhof: Jonas Hechinger, Klasse 9 von der Realschule. Gruppe ÖPNV: Christian Feuchtenböck vom bfz. Gruppe Auenpark: Johannes Simmet vom bfz. Gruppe Geyersberg: Florian Terhart und Alexander Hofmann von der Klasse 10 des Gymnasiums. Gruppe Veranstaltungen: Alina Rippl und Selina Gabauer von der Klasse 10 des Gymnasiums.
ZUKUNFTSSTADT
Der Wettbewerb „Zukunftsstadt“ soll zeigen, wie Bürger und Forschung dazu beitragen können, Städte lebenswert zu gestalten. 1,75 Millionen Euro stellt das Bundesbildungsministerium dafür insgesamt bereit.
Die erste Phase ist vorbei, für die zweite Phase werden dann 25 Vorschläge von einer Jury ausgewählt und mit 200 000 Euro bezuschusst. Wann das sein wird, ist noch nicht bekannt. In der dritten Phase ab 2018 werden schließlich bis zu acht Kommunen ihre Ideen in sogenannten „Reallaboren“ in die Praxis umsetzen. Die Höhe der Bezuschussung ist hier noch offen.
PNP, 18.03.2016 | Doris Löw

Sitzung am Montag, 14. März, um 18.30 Uhr
Freyung. Es geht nicht nur um das Gewerbegebiet und den Knoten Ort bei der nächsten Stadtratssitzung am Montag, 14. März, um 18.30 Uhr im Tagungsraum des Kurhauses (siehe Bericht S. 31). Auf der Tagesordnung stehen außerdem zahlreiche weitere Punkte, so die Präsentation der Ergebnisse des Projektes „FreYoung“.
Auch Beratung und Beschluss des Haushaltes 2016 stehen auf dem Plan, die Genehmigung des Bauentwurfs für die Erneuerung der Brückenüberbauten über den Saußbach bei der Mittermühle für die Westspange Freyung, eine Änderung der Außenbereichssatzung „Feldscheid“, die Festlegung des Stadtumbaugebietes „Geyersberg-Solla“ − schon mit Blick auf die angestrebte Kleine Landesgartenschau 2025 − sowie die Vergabe der Verfeinerung des Masterplan Geyersberg und einen Aufnahmeantrag in das Städtbauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“.
Für die Sanierung der Räume im 1. OG des Gebäudes Stadtplatz 1 ist ein Nachtrag notwendig, ebenso für den Feuerwehrhaus Neubau, wo auch die Vergabe von Estricharbeiten ansteht. Für die Volksmusikakademie soll der Stadtrat den Auftrag zur Erstellung einer Homepage vergeben. Außerdem gibt es zu den Kindergärten Infos über die Betriebskostenförderung 2016 nach dem BayKiBiG Kindergärten und es wird über Bauanträge und Bauvoranfragen entschieden.
PNP, 12.03.2016 | Löw

 Schüler des Gymnasiums und des BFZ fertigen detailgetreue Modelle zu „FreYong“-Projekt an
Schüler des Gymnasiums und des BFZ fertigen detailgetreue Modelle zu „FreYong“-Projekt an
Freyung. Das Projekt „FreYoung“ ist auf der Zielgeraden (PNP berichtete). Und um die Vorschläge , wie sich die Jugend ihre Heimatstadt wünscht auch anschaulich darzustellen, stand in der vergangenen Woche am Gymnasium Freyung ein Nachmittag mit Modellbau auf dem Programm.
Unabhängig voneinander hatten Franz Häuslmeier, Kunstlehrer am Gymnasium Freyung, und Frau Götz, Lehrkraft am BFZ Freyung (Berufliches Fortbildungszentrum) die Idee, die geplanten Projekte im Rahmen von „FreYoung“ auch optisch besser zu veranschaulichen.
„FreYoung“ läuft bereits seit Oktober 2015. Seitdem wurden regelmäßige Treffen und Workshops abgehalten. „Besonders wichtig ist neben den Ergebnissen, die wir dann dem Stadtrat vorstellen wollen, der Austausch der verschiedenen Schulen, die gute Teamarbeit, die mehr und mehr entsteht und natürlich das selbstständige Arbeiten der Schülerinnen und Schüler“, so Götz vom BFZ Freyung.
Dieser Workshop fand nur in kleinerer Besetzung statt, acht Schülerinnen und Schüler des BFZ nahmen daran teil und fünf des Gymnasium Freyung. Zwei der geplanten sechs Projekte, die angepackt werden, wollte man maßstabsgetreu nachbauen, um so an einem größeren Modell (ca. 1,5 m auf 1,5 m) die Höhenstrukturen, Straßenverläufe und Gebäude besser sehen zu können. Man hatte sich für die Projekte entschieden, bei denen ein solches Modell am meisten Nutzen hat: die Umgestaltung beziehungsweise das „Aufmotzen“ des Geyersbergs und eine Open-Air- und Festivalgestaltung in der Au. Aus diesem Grund wurden eben der Geyersberg und die Au nachgebaut.
Dieser „3-D-Modellbau“ am Gymnasium Freyung wurde von Franz Häuslmeier mustergültig vorbereitet. Die Schablonen für die einzelnen Schichten waren bereits vorbereitet, so dass sich die Schülerinnen und Schüler gleich an die Arbeit machen konnten. Zuerst mussten mehrere kleine, dünne Styroporplatten zu einer großen Platte zusammengeklebt werden.
Anschließend wurden die Umrisse der jeweiligen Höhenschicht mit Hilfe eines Tageslichtprojektors und einer vorgefertigten Schablone an einer Wand abgebildet, die Styroporplatte an die Wand gehalten und die Umrisse fein säuberlich nachgezeichnet. Im nächsten Schritt wurden diese Kanten dann mit Hilfe von Teppichmessern ausgeschnitten. Um ein möglichst genaues Modell zu bekommen, war hier millimetergenaues Arbeiten notwendig.
Nach dem Herausarbeiten der Konturen konnte dann Schicht für Schicht übereinander gebaut werden, bis zu 15 Schichten, so dass eine richtige Reliefstruktur entstand. In einem weiteren Schritt müssen jetzt noch die Feineinheiten erarbeitet werden (Straßenverlauf, Gebäude, usw.).
Dann ist man für die Präsentation beim Freyunger Stadtrat am 14. März bestens gerüstet. Dort werden in einer fünfminütigen Präsentation auch die anderen Projekte vorgestellt in den Bereichen Auenpark, Busbahnhof, Öffentlicher Personennahverkehr und Langgarten.
Zum Abschluss dieses Workshops war man sich einig, dass die Idee große Modelle vom Geyersberg und der Au anzufertigen richtig gut war. Die praktische Arbeit war eine sehr gute Ergänzung zu den anderen, eher theoretischen Workshops. „Das Konturennachzeichnen, das Ausschneiden und zusammenführen der einzelnen Styroporplatten hat sehr viel Spaß gemacht und ist auch richtig gut geworden“, so die Schüler des BFZ Freyung.
Auch die Projektleitung um Anna Marquardt und Stefan Küspert (beide Technologiecampus Freyung) waren sehr zufrieden. „Man hat gemerkt, mit wie viel Eifer die Schülerinnen und Schüler mit dabei waren. Nach der Erklärung am Anfang haben die Schüler sehr eigenständig gearbeitet“, so Marquardt. „In den nächsten Wochen stehen jetzt noch die Feinheiten an, um dann für die Stadtratssitzung am 14. März bestens gerüstet zu sein. Wie dann der Stadtrat auf die Vorschläge und Initiativen der Schüler reagiert, wird man dann sehen. Wir sind gespannt.“ ans
PNP, Andreas Schaub - 24.02.2016

 Jugendliche stellen Vorschläge demnächst im Stadtrat vor
Jugendliche stellen Vorschläge demnächst im Stadtrat vor
Freyung. Ein „lebenswerteres und nachhaltigeres Umfeld“ soll in der Kreisstadt durch das Projekt „freYoung“ geschaffen werden − und hier ist vor allem die Jugend gefragt. Was wünschen sich die Jugendlichen für ihre Heimatstadt in der Zukunft? Das war die zentrale Frage in einem Workshop, der nun im Rahmen des Projekts im Kurhaus stattgefunden hat.
Fünf Gruppen, zusammengesetzt aus Schülern der Mittelschule, Realschule, des Gymnasiums und des Beruflichen Fortbildungszentrums (BFZ), entwickelten deshalb am Donnerstag in einem Workshop ihre Ideen für ihr zukünftiges Freyung weiter, um sie dann am Montag, 14. März, dem Stadtrat zu präsentieren. Das Konzept der Schüler wird danach wissenschaftlich und umsetzungsreif vom Projektpartner Technologie Campus ausgearbeitet und beim deutschlandweiten Wettbewerb „Zukunftsstadt“ eingereicht. Beim Erreichen der nächsten Runde winken 200 000 Euro vom Bildungsministerium. In einem ersten Workshop erdachten sich die Jugendlichen vor einiger Zeit bereits Ideen und teilten sich in die Projektgruppen „ÖPNV“, „Geyersberg“, „Veranstaltungen“, „Busbahnhof“ und „Gestaltung des öffentlichen Raums“ ein. Um alle einzubinden, startete man auch eine Online-Umfrage. „Die Jugendlichen lernen schulübergreifend ein Projekt zu planen und zu präsentieren“, erklärt Konversionsmanager Raimund Pauli von der Stadt. Daraus entstanden dann u.a. Ideen für eine Panorama-Sauna am Geyersberg oder eine Muster-Bushaltestelle. Im Stadtrat werden die Vorschläge der Jugendlichen dann priorisiert und mit Finanzierungsplänen hinterlegt und könnten danach verwirklicht werden: Entweder durch die Stadt selbst oder durch das Fördergeld, wenn das Konzept der Schüler, als eins unter 25 weiter Vorschlägen, die zweite Phase des Wettbewerbs „Zukunftsstadt“ erreicht.
DAS PROJEKT
Der Wettbewerb „Zukunftsstadt“ soll zeigen, wie Bürger und Forschung dazu beitragen können, Städte lebenswert zu gestalten. 1,75 Millionen Euro stellt das Bundesbildungsministerium dafür insgesamt bereit. Bundesweit hatten sich 168 Städte, Gemeinden und Landkreise für die Teilnahme beworben. 52 Kommunen, insgesamt fünf aus Bayern und darunter auch Freyung, wurden von einer Expertenjury ausgewählt.
In der aktuell laufenden ersten Phase des Wettbewerbs wird mit Beteiligung der Bürger − dafür wurde „freYoung“ gegründet − eine Vision für die Kommune entwickelt und die Vorschläge werden zu einem umsetzungsreifen Konzept entwickelt.
Für die zweite Phase des Wettbewerbs werden dann 25 Vorschläge von einer Jury ausgewählt und mit 200 000 Euro bezuschusst. Wann das sein wird, ist noch nicht bekannt. Die erste Phase läuft ja noch bis 31. März. In der dritten Phase ab 2018 werden schließlich bis zu acht Kommunen ihre Ideen in sogenannten „Reallaboren“ in die Praxis umsetzen. Die Höhe der Bezuschussung ist hier noch offen.ho
PNP, ho - 20.02.2016

 Donau-Wald-Presse GmbH gibt dritte Auflage des Wirtschafts- und Innovationsmagazins „FRGenial“ heraus
Donau-Wald-Presse GmbH gibt dritte Auflage des Wirtschafts- und Innovationsmagazins „FRGenial“ heraus
Freyung-Grafenau. „FRGenial“ die Dritte − das Magazin für Innovation und Technik in der Region Freyung-Grafenau lädt einmal mehr zum Staunen ein. Als Gemeinschaftswerk der Donau-Wald-Presse GmbH mit dem Landkreis FRG, der Stadt Freyung, dem Technologie Campus Freyung sowie Atelier & Friends präsentiert es auf 52 Seiten den Erfolg und die Innovationskraft „herausragender“ wie auch eher „versteckt“ wirkender Unternehmen und Akteure in der Region.
Freyungs Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich, der vor über sechs Jahren die Idee zu diesem besonderen „Schaufenster“ eines aufstrebenden Bayerwald-Landstrichs hatte, gibt sich bei der Präsentation der dritten Auflage überrascht: „Beim Durchblättern entdeckt man immer wieder etwas, was man noch nicht kannte.“ Das Magazin zeige „eine wunderbare Bandbreite dessen, was der Landkreis zu bieten hat − und beweist so eindrucksvoll, dass man bei uns nicht nur schöne Natur findet, sondern dass man hier sehr gut leben und hochqualifiziert arbeiten kann“.
Landrat Sebastian Gruber sieht das genau so: „Ein erfolgreiches Projekt dank guter Zusammenarbeit − das Konstrukt der Herausgeber hat sich bewährt.“ FRGenial werde im Landratsamt von Wirtschaftsförderung und Regionalmanagament als sehr hilfreich angenommen − „ein unterstützendes Werk für uns mit dem Ziel, auf die Potenziale im Landkreis aufmerksam zu machen.“
DWB-Geschäftsführer Reiner Fürste lobt vor allem die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten im Herausgeberbeirat, der sich während der Entstehung des Magazins regelmäßig getroffen hat. „Das war eine Menge Arbeit, aber mittlerweile funktioniert die Zusammenarbeit blind.“ So etwas könne man nur gemeinsam schaffen, „ein Einzelner könnte das nicht“. Fürst überbrachte die Grüße von Verlegerin Simone Tucci-Diekmann, die stolz darauf sei, „dass wir solche Projekte in unserem Haus machen“.
Die Akquise sei etwas schleppend angelaufen, berichtet Projektleiterin Katja Köck, aber dank der guten Unterstützung sei es gelungen, letztlich den selben Seitenumfang gestalten zu können wie bei den vorherigen Ausgaben.
Enstanden ist mehr als „nur“ ein Heft. „Für uns ist dieses Werk ein Botschafter“, sagt Markus Pühringer als Geschäftsführer von Atelier & Friends: „Man muss das, was man über den Landkreis zu sagen hat, nach außen tragen, und die Menschen zeigen, die für Innovation stehen.“ Sein Unternehmen habe FRGenial im Rahmen einer Mailingaktion eingesetzt − und eine stolze Anzahl von Kunden damit gewonnen. „Hier wird Kompetenz überzeugend dargestellt.“
Kristina Wanieck vom Technologie Campus Freyung meint, der Campus fühle sich als wichtiger Teil dieses Projekts, in dem es ja auch um Technologien geht. „Wir sehen uns als Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft.“
Wirtschaftsreferent Ralph Heinrich nützt das Magazin „sehr gerne, um in der Region und darüber hinaus Werbung zu machen.“ Landkreis-Botschafter, Abgeordnete, Kreisräte, Bürgermeister, Touristiker − sie alle werden mit FRGenial „ausgestattet“. Und dass „Invest in Bavaria“ eine PDF-Version des Magazins auf seine Homepage stelle, bedeute sogar „Werbung weltweit“.
Doch auch Schulabsolventen erhalten das Werk, wie Regionalmanager Stefan Schuster sagt: „Das ist ein gutes Marketing-Instrument, um nach innen und nach außen den Landkreis selbstbewusst zu vertreten.“
„FRGenial 2016“ hat eine Auflage von 4000 Exemplaren. Erhältlich ist das Magazin auch in den Geschäftsstellen der PNP im Landkreis.
PNP, Peter Püschel - 03.12.2015

![]() Alle Handlungsfelder sind besetzt – Gemeinsamer Messeauftritt beim Passauer Frühling
Alle Handlungsfelder sind besetzt – Gemeinsamer Messeauftritt beim Passauer Frühling
2016
Tiefenbach. „Die ILE Passauer Oberland kommt in Schwung“, so das Fazit des Vorsitzenden, Bürgermeister Stephan Gawlik aus Fürstenstein. Alle Handlungsfelder der Agenda seien besetzt mit zwei Bürgermeistern.
Seit drei Jahren kümmerte sich die Gemeinde Fürstenstein, allen voran Geschäftsleiter Michael Bauer, um den Geschäftsbetrieb der ILE – zum Nulltarif. Das ändert sich: Auf Vorschlag von Bürgermeister Georg Steinhofer (Neukirchen vorm Wald) zahlt künftig jede Mitgliedsgemeinde eine jährliche Kostenerstattungspauschale von 500 Euro.
Den Reigen der Berichte aus den einzelnen Handlungsfeldern eröffnete Josef Pauli vom Technologie-Campus Freyung, Energieberater der ILE: Er hat Endverbrauch und Kosten für Wärme, Strom und Verkehr der einzelnen ILE-Gemeinden ausgewertet. Ergebnis: Fast alle erfüllen bereits das Klimaschutzziel der Bundesregierung, von 1990 bis 2020 den CO²-Ausstoß um 20 Prozent zu verringern. Für die Förderperiode ab März 2016 legte er den Bürgermeistern einen 19-Punkte-Plan vor, wie Energieverbrauch und Kosten für gemeindliche Liegenschaften gesenkt werden können. So sollte etwa geprüft werden, das sogenannte „Straßenbegleitgrün“ von Gemeindeverbindungsstraßen nicht zu mulchen, sondern zu Laubpellets verarbeiten zu lassen und damit kommunale Gebäude zu beheizen. Die Bürgermeister stimmten unisono für das Konzept von Josef Pauli, der zum Ende des Jahres seine Beratertätigkeit für die ILE Passauer Oberland beendet.
In Sachen Ortsentwicklung berichtete Thomas Schöffel vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in Landau/Isar, über den sogenannten „Vitalitäts-Check“. Lediglich zwei Unternehmen hätten ein Angebot abgegeben, über die Vergabe entscheidet das ALE, da der Vitalitäts-Check für die Gemeinden kostenlos ist.
Beim Handlungsfeld Wirtschaft und Bildung berichtete Projektmanagerin Gabriele Bergmann über das Vorbereitungstreffen für die DreiLänderMesse „Passauer Frühling“ mit den ILE Passauer Oberland und Ilzer Land. Damit das ALE bei der finanziellen Förderung einsteigt, verlangt es eine eigene Beraterecke für Eigenwerbung in Halle 4, die von den beiden ILEs belegt wird. Zudem sind in der Halle noch drei Stände frei – die Projektmanagerin wünscht sich etwa eine Bäckerei oder einen Raumausstatterbetrieb.
Tiefenbachs Bürgermeister Georg Silbereisen berichtete vom Unternehmerforum im Gasthaus Knott mit 60 Firmenvertretern. Die Mehrheit sprach sich für einen halbjährlichen Rhythmus solcher Treffen aus, bei den Themenbereichen entfielen auf Fördermaßnahmen, Suche von Auszubildenden und Energie die meisten Nennungen.
Beim Handlungsfeld Tourismus und Freizeit berichtete Egings Bürgermeister Walter Bauer über die Highlights 2015, die Wanderung „Genuss am Fluss“ und die 12-Stunden-Wanderung im Dreiburgenland.
Der Verantwortliche für das Handlungsfeld Demographie, Rudertings Bürgermeister Rudolf Müller, berichtete unter anderem von der Kooperation der ILE Passauer Oberland mit dem Münchner Verein „Lichtblick Seniorenhilfe“, der Rentner mit geringem Einkommen unterstützt. Weiter sprach er den Rudertinger Nachbarschaftshilfeverein an, den Tittlinger Helferkreis zur Entlastung pflegender Angehöriger und die Seniorenbeiräte. Er regte an, dass ein Netzwerk der Seniorenvertreter der ILE-Gemeinden geknüpft werden und gegebenenfalls in der zweiten Jahreshälfte eine Info-Veranstaltung mit externen Partnern wie der Caritas stattfinden soll. Bürgermeister Stephan Gawlik berichtete vom Seniorentag der ILE Ilzer Land, den er sich auch für die Senioren der Oberland-Gemeinden vorstellen könne.
Beim Handlungsfeld Interkommunale Zusammenarbeit berichtete Josef Ragaller, Geschäftsleiter von Aicha vorm Wald, vom Treffen mit seinen Kollegen der ILE-Gemeinden. Themen waren unter anderem die regelmäßig durchzuführende Feuerbeschau bei Betrieben. Dazu könne man sich des Kommunalen Unfallversicherungsverbandes Bayern bedienen, Stundensatz: 50 Euro. Einsparpotenziale sehen die Geschäftsleiter auch bei gemeinsamen Beschaffungen für die Verwaltungen und Bauhöfe.
Bei den laufenden Projekten der ILE-Gemeinden sprach Rudertings Bürgermeister die Entsorgung des Klärschlamms an. Seine Gemeinde habe derzeit 300 Kubikmeter in einer privaten Güllegrube zwischengelagert, da die Anschaffung einer Klärschlammpresse für 260 000 Euro erst geklärt werden müsse. Über ein positives Ergebnis der Probe-Klärschlammpressung berichtete Fürstensteins Bürgermeister Stephan Gawlik. Auf seinen Vorschlag hin wollen sich Aicha, Fürstenstein, Ruderting und Salzweg abstimmen, ob bei einer gemeinsamen Ausschreibung günstigere Preise zu erzielen sind.
Beim Ausblick für 2016 schlug Gabriele Bergmann unter anderem vor, im Handlungsfeld Energie neben den Kommunen auch Unternehmen und Betrieben das Beratungsangebot zuteil werden zu lassen. Für Eigentümer von Leerstandsimmobilien soll es verstärkt Beratungsangebote Nutzung geben. Beim Handlungsfeld Verwaltungskooperation warb sie für eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit. Im Handlungsfeld Wirtschaft und Bildung wurde die Beratung von Gemeinden, die bereits Flüchtlinge untergebracht haben, und der dort ansässigen Betriebe zur Integration der Asylsuchenden in den Arbeitsmarkt als wichtig angesehen.
Wie Thomas Schöffel erklärte steht in der zweiten Jahreshälfte 2016 eine Evaluierung der ILE Passauer Oberland an, mit Fragestellungen wie „Was läuft gut, was läuft weniger?“, „Wo sind Anpassungen notwendig“, „Wie macht die ILE weiter“?
Die nächste ILE-Beteiligtenversammlung findet im Frühjahr 2016 in Ruderting statt.
PNP, Hans Schauer - 02.12.2015

 Auf Katzenpfoten durch die Straßen
Auf Katzenpfoten durch die Straßen
Was Katzenpfoten mit Autoreifen zu tun haben oder wer der Erfinder des Klettverschlusses war, konnten letzten Freitag die jungen Forscherinnen und Forscher der Kinderuni erfahren. Im brechend vollen
Hörsaal des neuen I-Gebäudes der Technischen Hochschule Deggendorf entführte Kirsten Wommer vom Technologiecampus Freyung ihre Zuhörerschar in die Welt der Bionik.
Den Begriff Bionik, zusammengesetzt aus Biologie und Technik, gibt es seit den 1960er Jahren. Er bezeichnet ein Forschungsgebiet, in dem Phänomene der Natur abgeschaut und in technische Lösungen übertragen werden. Dies können zum Beispiel die Form oder die Farbe von Pflanzenteilen mit besonderer Funktion sein, etwa das Blatt der Lotusblume, das eine selbstreinigende Oberfläche aufweist. Diese Oberflächenstruktur macht man sich bereits bei Fassadenfarben zu nutze. Auch komplexe Prozesse in der Natur, wie das menschliche Laufen oder das Fliegen der Vögel, sind ideale Vorbilder für technische Entwicklungen, so werden die Flügelformen und –stellungen bei Vögeln im Flugzeugbau kopiert. Und noch eine Dimension weitergedacht, können wir auch von ganzen Ökosystemen lernen, deren Zusammenwirken verstehen und für uns nützlich machen.
Begeistert rätselten die Kinderuni-Teilnehmer beim Bionik-Quiz mit. In Gruppen sollten die jungen Forscher die natürlichen Vorbilder ihren technischen Verwendungen zuordnen. Was bei der Samenkapsel der Mohnblume und dem Salzstreuer noch einfach war, wurde dann doch recht schwierig, als am Ende bei fast allen ein Autoreifen und die Katzenpfoten übrig blieben. Was könnten diese beiden Begriffe miteinander zu tun haben? Kirsten Wommer lüftete das Geheimnis wie folgt: Wenn Katzen ganz plötzlich aus vollem Lauf abbremsen, dann schmiegen sich deren Fußsohlenpolster fest an den Untergrund und vergrößern damit die Auflagefläche der Pfote beträchtlich. Dies erhöht die Bremsleistung. Genau diesen Effekt nutzen Ingenieure bei der Entwicklung von Autoreifen mit kürzerem Bremsweg aus.
Auf ebenso viele neugierige Zuhörer freut sich das Kinderuni-Team der THD auch bei ihrer nächsten Kinderuni am 11. Dezember um 17:00 Uhr im Hörsaal I 107. Dann heißt es: „Was machen eigentlich Klinikclowns?“. Gestaltet wird die Kinderuni von Prof. Dr. Michael Bossle, selbst als Klinikclown tätig, und von Mira Neumeier vom Wandertheater Mira aus Landau an der Isar. Eingeladen sind alle Wissbegierigen zwischen 8 und 13 Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer mag, kann sich vor Ort für einen Studentenausweis eintragen und dann bei jedem Kinderuni-Besuch einen Aufkleber sammeln, um später ein Kinderuni-Diplom zu erhalten. Begleitpersonen dürfen der Vorlesung in den hinteren Reihen beiwohnen, sofern noch Platz im Hörsaal ist.
Bild: Kirsten Wommer (links im Bild) dirigiert die Kinder-Studierenden im prall gefüllt Hörsaal des neuen I-Gebäudes für das Bionik-Quiz.
THD Hochschulpresse - 01.12.2015


 Bionik-Vortragsreihe am Technologie Campus - Neue Fassadenbeschichtung vorgestellt
Bionik-Vortragsreihe am Technologie Campus - Neue Fassadenbeschichtung vorgestellt
Freyung. Oberflächen mit besonderen Eigenschaften zählen zu den Klassikern der Bionik-Forschung. Lotuseffekt, Gecko-Tape und Klettverschluss sind nur einige Beispiele, die daraus erfolgreich hervorgegangen sind. Bei der diesjährigen Bionik-Vortragsreihe am Technologie Campus Freyung wurden zwei Projekte aus Wissenschaft und Wirtschaft vorgestellt.
Prof. Dr. Martin Aust, Leiter der Arbeitsgruppe Bionik in Freyung, startete mit einem Vortrag über die Forschung an leicht zu reinigenden Oberflächen. Insbesondere Kunststoffoberflächen stehen in seiner Forschung im Mittelpunkt. „Sie kommen in vielen Gegenständen des Alltags vor, wie z.B. Karosserien, und sind häufig starken Umweltbelastungen ausgesetzt. Wir wollen dazu beitragen, zur Lebens- und Nutzungsdauer dieser Produkte sowie zur Reduzierung von Reinigungsaufwänden beizutragen, indem wir Verschmutzung verhindern und Reinigung erleichtern“, fasst Prof. Aust seine Forschung zusammen.
Das Phänomen der Selbstreinigung findet man mehrfach in der Natur und ihre Grundlagen sind gut bekannt. In Freyung arbeitet man nun an der technischen Umsetzung. Das Ziel sind neue marktfähige Produkte.
Im zweiten Vortrag stellte Reiner Schmid von der Sto SE & Co. KGaA ein solches Produkt vor. Die neueste Entwicklung der Firma Sto ist eine Fassadenbeschichtung, die stets trocken bleibt. Inspiriert wurde die Entwicklung vom Nebeltrinkerkäfer. Der in der Namib-Wüste lebende Käfer kann Wasser aus der Luft auf seiner Körperoberfläche sammeln und gezielt zu seinem Mund leiten. Dies wird durch besondere Eigenschaften der Oberfläche erreicht, die Wasser mal anzieht und mal abstößt. Dieses Prinzip wurde für Fassaden übertragen und nun leiten diese beschichteten Fassaden Wasser gezielt ab. Die Fassade trocknet sich dadurch von selbst. „Die Entwicklung unseres neuesten Produktes hat mehrere Jahre gedauert. Bionik ist spannend, faszinierend, erfordert aber auch Zuversicht und Durchhaltevermögen − und zahlt sich am Ende aus“, beschreibt Reiner Schmid den Weg zum Innovationserfolg.
Bereits zum siebten Mal fand die Vortragsreihe mit Unterstützung des Fördervereins Technologie Campus Freyung e.V. am TCF statt. Auch dieses Mal konnten insbesondere bei der anschließenden Diskussion interessante Fragestellungen erörtert und neue Kontakte geknüpft werden. pnp - 07.11.2015

Pressemeldung:
Im Rahmen des Forschungsvorhabens „PUBinPLAN“ des Technologie Campus Freyung wurden erste Ortsbegehungen in der Stadt Pegnitz unter wissenschaftlicher Begleitung von Herrn Stefan Küspert durchgeführt.
Der Projektpartner KlimaKom hat dem TCF das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Pegnitz als Fallstudie zur Verfügung gestellt, um empirische Sozialforschung zu dem Thema Partizipation in der Planung durchführen zu können. Dabei werden sowohl quantitative Fragebögen an die Bürger ausgegeben, als auch qualitative Interviews mit Experten und Meinungsbildnern, wie z.B. dem Bürgermeister der Stadt Pegnitz geführt. Die Ortsbegehungen gaben den Bürgern einen geeigneten Rahmen, Vorschläge zur Verbesserung ihres Nahraumes abzugeben und sich Gehör in der Stadtverwaltung zu verschaffen.
Erfreulicherweise weckten die technologischen Entwicklungen von PUBinPLAN bei Bürgern und Experten große Aufmerksamkeit. So können sich die Beteiligten durchaus vorstellen zukünftige Projekte mit der am TCF entwickelten Applikation zu begleiten, um mehr Bürger am Planungsprozess teilhaben zu lassen. „
Nordbayerischer Kurier - 10.10.2015, Foto: Ralph Münch

![]() Bei Aktion "FreYoung" bringen Schüler ihre Ideen für Freyung ein - Schülerrat soll gegründet werden
Bei Aktion "FreYoung" bringen Schüler ihre Ideen für Freyung ein - Schülerrat soll gegründet werden
Freyung.„Wir freuen uns sehr, dass ihr euch dazu entschlossen habt, bei „FreYoung“ mitzumachen und wünsche euch einen erfolgreichen Tag“, mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich rund 50 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule, der Realschule, des Gymnasiums und des BFZ (Berufliches Fortbildungszentrum). Die Stadt Freyung ist dabei eine von 52 Teilnehmern am Wettbewerb „Zukunftsstadt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Hauptziel ist es, mit Jugendlichen den öffentlichen Stadtraum der Zukunft zu gestalten.
In Zusammenarbeit mit den Jugendlichen soll gewährleistet werden, dass ihre Bedürfnisse und Wünsche stärker in die Stadtentwicklung und -planung miteinfließen. Zudem soll das generationsübergreifende Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt werden und auch öffentliche Vereine und Organisationen mit ins Boot geholt werden. Es sollen konkrete Visionen und Ideen ausgearbeitetwerden. Außerdem soll ein Jugendrat gegründet werden, der sich am Entwicklungsprozess der Stadt Freyung beteiligt. Nach dem Bekanntmachen dieses Projektes an den Freyunger Schulen fand nun das konstituierende Treffen im Kurhaus statt, zudem50 engagierte Schüler gekommen waren. Nach einer Begrüßung durch BürgermeisterHeinrich folgte eine Vorstellungsrunde der Projektverantwortlichen: Konversionsmanager Raimund Pauli ist von der Stadt Freyung zuständig, ebenso wie Stadtjugendpflegerin Melanie Haselberger. Sie bekommen Hilfe von Mitarbeitern des Technologie Campus Freyung, von Anna Marquardt, Stefan Küspert und Lena Schandra. Zunächst wurde eine Aktivierungsrunde gemacht, um die Teilnehmer für das Thema und die Problematik zu begeistern, anschließend wurden Thementische durchgeführt zu ausgewählten Themen. In Kleingruppen fand zu dem jeweiligen Thema ein Brainstorming statt und neue Ideen, Probleme und Handlungsbedarf wurden angesprochen. Am Ende dieser Runden wurden von den Projektleitern die wichtigsten Ergebnisse im Plenum vorgestellt. Melanie Haselberger war für den Thementisch „Gastronomie/ Einzelhandel“ zuständig und ließ die Kinder und Jugendlichennicht nur Ideen sammeln, sie ging auch sehr kreativ und fiktiv an die Sache heran und ließ die Ideen auch gleich in den Freyunger Stadtplan einzeichnen. Leerstände wurden gefüllt, Häuser abgerissen und neuoder umgebaut. Raimund Pauli hatte mit dem Themengebiet „Kulturelles Angebot/Soziales/ Bildung“ ein breites Spektrum abzudecken, das zeigen auch die vielfältigen Vorschläge, die hier gemacht wurden. Stefan Küspert besprach mit den Schülern Ideen und Probleme zu den Punkten „Verkehr und Mobilität“, ein sehr wichtiger Aspekt gerade in unserem ländlichen Gebiet. Bei Lena Schandra gab es zum Thema „Freizeit und Tourismus“ mit die meisten Ideen und Vorschläge und auch bei Anna Marquardt, die sichumdie Thematik „Stadtbild und Grünflächen“ kümmerte, gab es viele interessante Ansatzpunkte. Mit diesen vielen Ideen, Wünschen und Anregungen (siehe Kasten) werden sich die Projektleiter von „FreYoung“ nun an die Stadt Freyung wenden und mit den dort Verantwortlichen zusammensetzen. Allen ist bewusst, dass Vielesnicht oder nur sehr schwer umsetzbar sein wird, dennoch wird versucht, dass möglichst viele Punkte angepackt werden. Zu diesem Zweck werden auch Mentoren gesucht, die die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit unterstützen. Sie sollen vor allem bei der praktischen Umsetzung helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen und die Teilnehmer „an die Hand nehmen“. Nach diesem ersten Schritt in Richtung „Zukunftsstadt“ mit dem konstituierenden Treffen folgt bereits in wenigen Tagen die Infoveranstaltung für die Mentoren (siehe Kasten). Am 17. November findet dann der erste Workshop-Tag statt, bei dem die Kinder und Jugendlichen sich dann viel konkreter mit einzelnen ausgewählten Projekten befassen werden. Im Januar 2016 schließt sich dem ein zweiter Workshop-Tag an. Das Ende dieses Projektes ist dann im März 2016 mit einer Was Jugendlichen in ihrer Stadt wichtig ist Bei Aktion „FreYoung“ bringen Schüler ihre Ideen für Freyung ein - Schülerrat soll gegründet werden großen Abschlusspräsentation, bei der dann die entwickelten Projekte vorgestellt werden. Abschließend war sich jedenfalls der Großteil der anwesenden Schüler darin einig, dass man gute Ideen gesammelt habe und auf einem konstruktiven Weg sei.
Von Andreas Schaub, PNP - 20.10.2015

 Impulsveranstaltung soll Schüler der Realschule informieren
Impulsveranstaltung soll Schüler der Realschule informieren
Freyung. „Mit Jugendlichen den öffentlichen Stadtraum der Zukunft gestalten“, das ist das Ziel des Projekts „freYoung“, das den Schülern an der Realschule Freyung vorgestellt wurde.
Präsentiert wurde der Vortrag in der Aula des Technologie Campus Freyung. Zu Beginn stellte Stefan Küspert vom TC Freyung den Schülern allgemeine Fragen über die Stadt Freyung und erkannte so, wer gute Ortskenntnisse besitzt. Erklärt wurde auch, dass es 2006 schon einmal so ein Projekt gab und man das auch heute sehen könne, wenn man durch die Stadt geht. Durch Vorher-Nachher-Vergleiche wurde den Realschülern deutlich gemacht, was sich schon alles geän- „freYoung“ startet in den Schulen dert hat und woran weiterhin gearbeitet wird. „Wir wollen nach diesen sechs Monaten klare Ergebnisse sehen“, sagte Kirsten Wommer vom TC Freyung. Damit sprach sie die Schüler an, die sich für dieses Projekt bereit erklären würden, um dann mit den Mentoren für die Realschule „ins Rennen“ gehen zu können. Denn sechs Monate dauert diese Phase, dann steht die nächste Runde an. Auch stellte sich die Frage, wie die Stadt Freyung im Jahre 2025 aussehen könnte? Anschließend bekam jeder Schüler eine rote und eine grüne Karte. Die Aufgabe war es, bei Grün eine Sache aufzuschreiben, die einem an der Stadt gefällt und bei Rot eine Sache, die einem nicht gefällt bzw. die verbessert werden könnte. Die Karten wurden anschließend wieder eingesammelt und ausgearbeitet. Außerdem war ein Luftbild von Freyung und Umgebung auf dem Boden der Aula ausgebreitet und die Jugendlichen mussten bestimmen, was noch zur Stadt Freyung gehört. Mit einer gelben Schnur umrahmten sie dann diesen Teil und man konnte so die Aufteilung der Orte gut erkennen. Vom TC Freyung waren außerdem an der Realschule anwesend: Anna Marquardt, Lena Schandra und Professor Roland Zink.
amb, PNP - 08.10.2015

 Stadtrat erteilt TC den Auftrag für wissenschaftliche und organisatorische Umsetzung − 100 Prozent Fördergeld
Stadtrat erteilt TC den Auftrag für wissenschaftliche und organisatorische Umsetzung − 100 Prozent Fördergeld
Freyung. „Kosten tut‘s schon was - aber nicht für die Stadt Freyung“, konstatierte 2. Bürgermeister Alexander Muthmann, als er die außertourliche Sitzung des Stadtrates in der Urlaubszeit leitete. Es ging dabei um das Projekt „freYoung“, mit dem sich die Kreisstadt für die Zukunft rüsten und dabei vor allem die Jugend mit ins Boot holen will - und für das optimalerweise auch viel Fördergeld fließt. Den Rahmen für dieses Projekt bildet nämlicheine Initiative des Bundesministeriums für Wissenschaft und Bildung; und Freyung hatte sich dafür erfolgreich beworben (PNP berichtete).
Nun hat der Stadtrat auch den Weg frei gemacht, dass die wissenschaftliche und organisatorische Umsetzung gewährleistet ist. Das kostet insgesamt 31 700 Euro, gefördert zu 100 Prozent vom Bundesbildungsministerium. Einstimmig wurde der Auftrag dafür an den Technologie Campus (TC) Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf vergeben. Die geplanten Aktivitäten für dieses Projekt wurden bei der Sitzung nochmals von Prof. Roland Zink vom TC Freyung vorgestellt. Gefragt ist vor allem die Mitarbeit von hiesigenSchülern, die ihre Ideen für die Zukunftsstadt Freyung einbringen sollen. Los gehen wird es bereits zum Beginn des neuen Schuljahres. Daher brauchte man nun die schnelle Zustimmung des Stadtrates. Fördergeld: Es fließen 100 Prozent Die Kosten für die Arbeit des TC im Rahmen von „freYoung“ werden zu 100 Prozent vom Bildungsministerium gefördert. So müssen für die Umsetzung der wissenschaftlichen Arbeitspakete im Projekt „freYoung“ 17 600 Euro indie Hand genommen werden. Das war das günstigste Angebot, das nach der Ausschreibung dieser Arbeiten bei der Stadt eingegangen ist. Es kommt vom Technologie Campus Freyung. Auch für die Umsetzung der organisatorischen Arbeitspakete in dem Projekt kam vom TC Freyung das günstigste Angebot in Höhe von 14 100 Euro. Bei dem Projekt „freYoung“ sind Ideen der Jugendlichen sowohl aus der Stadt als auch aus dem näheren Umkreis gefragt. Zusammen mit den lokalen Schulen, also Mittelschule, Realschule und Gymnasium, soll mit engagierten Jugendlichen u.a. ein Jugendbeirat installiert werden. Vor allem geht es dabei um die Gestaltung des öffentlichen Raumes: Wie sollen die Plätze und Einrichtungen der Stadt aussehen, damit sich auch die Jugend wohlfühlt und das Ambiente als lebenswert empfindet? Der Jugendbeirat wird unterstützt von der Stadtverwaltung, den Schulen, dem Technologie Campus, den Medien sowie speziell von einem Mentorenteam. Dieses soll sich aus Vertretern der lokalen Vereine, Institutionen und Organisationen zusammensetzen und den Jugendlichen bei der Entwicklung ihrer Zukunftsvisionen zur Seite stehen. Kein„Wunschkonzert“ solle es werden, betonte Zink, sondern realisierbare Ideen seien gefragt. Zum Schulstart soll es bereits losgehen Zum Zeitplan erläuterte Prof. Zink, dass er und sein fünfköpfiges Team bereits in den nächsten Tagen den Lehrerkollegien der teilnehmenden Mittelschule, Realschule und Gymnasium das Projekt vorstellen werden; zum Schulstart folgen entsprechende Vorträge in den Schulklassen. Bis in den Spätherbst soll sich eine Arbeitsgruppe Jugendbeirat konstituieren. DiesemBeirat gehören jeweils zwei Schüler aus jeder Klasse an und er wird von dem genannten Mentorenteam unterstützt. In der Folge sollen wöchentliche Treffen stattfinden, Fragebögen erarbeitet werden, die Jugendlichen können auch über neue Medien, Apps, Facebook-Gruppen u.ä. ihre Ideen für die Zukunftsstadt Freyung einbringen. Das werde dann laut Zink repräsentative Ergebnisse bringen, die wiederum von den Arbeitsgruppen ausgewertet werden. Bis März 2016 muss diese Phase abgeschlossen sein. Dann wird sich entscheiden, ob Freyung die nächste Hürde bei dem Projekt des Bundesministeriums gemeistert hat. Denn von den aktuell 52 beteiligten Kommunen werden laut Zink im kommenden Frühjahr nur 25 die nächste Stufe erreichen. Dabei stehen dann bis zu 250 000 Euro an Fördergeld zur Verfügung, um die zuvor erarbeiteten Projekte auch in die Tat umsetzen zu können, wie Zink sagte. Mentoren gesucht: Wer will mitmachen? Gesucht werden nun auch Mentoren, die die Schüler bei ihrer Arbeit unterstützen. Angesprochen sind dabei vor allem Vertreter der lokalen Vereine und Organisationen. Besondere Voraussetzungen brauche man nicht, wenn man hier dabei sein will, sagteProf. Zink auf die Frage von Stadtrat Thomas Friedsam (CSU). Jeder Interessierte könne sich einfach bei der Stadtverwaltung melden. Und eine Anregung von Stadtrat Josef Geis (CSU) hat sich der Professor gleich notiert: Als Anreiz zum Mitmachen solle man doch kleine Preise wie z.B. einen Ausflug oder eine Kurzreise ausloben. Wer also dabei sein will: Infos gibt‘s auch beim Konversionsmanager der Stadt Freyung Raimund Pauli unter Tel. 08551/588-166 oder per Mail: konversionsmanager@freyung. de DAS PROJEKT Der Wettbewerb „Zukunftsstadt“ soll zeigen, wie Bürger und Forschung dazu beitragen können, Städte lebenswert zu gestalten. 1,75 Millionen Euro stellt das Bundesbildungsministerium dafür insgesamt bereit. Bundesweit hatten sich 168 Städte, Gemeinden und Landkreise für die Teilnahme beworben. 52 Kommunen, insgesamt fünf aus Bayern und darunter auch Freyung, wurden von einer Expertenjury ausgewählt. In der aktuell laufenden ersten Phase des Wettbewerbs wird mit Beteiligung der Bürger - im Freyunger Fall also vor allem der Schüler und Mentoren - eine Vision für die Kommune entwickelt und Handlungs- bzw. Umsetzungsvorschläge werden erarbeitet. In der zweiten Phase ab 2016 prüfen ausgewählte Kommunen diese Vorstellungen wissenschaftlich und erarbeiten ein umsetzungsreifes Konzept. In der dritten Phase ab 2018 werden schließlich bis zu acht ausgewählte Kommunen ihre Ideen in sogenannten „Reallaboren“ in die Praxis umsetzen. Der Wettbewerb „Zukunftsstadt“ startet im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2015 - Zukunftsstadt, einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD).
Von Doris Löw, PNP - 01.09.2015

Seminarreihe startet am 14. September 2015
Perlesreut.
Rechtzeitig vor Beginn der neuen Heizperiode bietet das Handlungsfeld Energie im Ilzer Land zusammen mit dem Technologie Campus Freyung eine Seminarreihe zum Thema „Optimieren der Einstellungen von Heizungssteuerung und Heizkomponenten“ an.
Die Teilnehmer erhalten durch die Experten Hinweise, wie sie ihre eigene Heizungssteuerung und die zugehörigen Komponenten so einstellen können, dass sie künftig dadurch Energiekosten sparen. Im Regelfall sind es circa 10 Prozent, die durch eine Optimierung der Anlage eingespart werden können. Die Seminare richten sich an Eigenheimbesitzer und Gewerbetreibende gleichermaßen. Der erste der insgesamt drei Seminarabende findet am 14. September von 18.30 bis ca. 20.30 Uhr in der Bauhütte in Perlesreut, Marktplatz 11, statt. Der zweite Abend ist für den 21. September vorgesehen und der dritte Termin ist am 5. Oktober geplant. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr liegt bei einmalig 58 Euro. Die drei Abende sind aufeinander aufbauend und sehr praxisorientiert. Sie beinhalten folgende Themen: Einstellen der eigenen Heizkennlinien, eigene Steuerungskomponenten richtig nutzen, Einstellen der eigenen Warmwasser- und Speichertypen, Einstellen der eigenen Heizkreispumpen sowie Erfahrungsaustausch mit praktischer Hilfestellungund Anwendung. Als Unterlagen sollten die Betriebsanleitungen der eigenen Heizungssteuerungen und – nach Möglichkeit – die aktuell eingestellten Werte mitgebracht werden. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 9. September, an den Klimaschutzmanager der ILE Ilzer Land Matthias Obermeier, unter "08582 979709-0 oder mo@ nigl-mader.de erbeten.
ul - PNP - 26.08.2015

 Erfahrungen sammeln: Doktoranden am Technologie Campus sind zu Forschungszwecken ins Ausland
Erfahrungen sammeln: Doktoranden am Technologie Campus sind zu Forschungszwecken ins Ausland
Freyung. Dank der engen Kooperation der THD Technische Hochschule Deggendorf mit Universitäten weltweit können wissenschaftliche Mitarbeiter auch am Technologie Campus Freyung promovieren. Derzeit sind drei Doktoranden in Freyung beschäftigt, von denen zwei für einige Zeit ins Ausland gegangen sind.
Kristina Wanieck ist seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Bionik. Sie hat sich darauf spezialisiert, Bionik als Methode weiterzuentwickeln. „Ich möchte mit meiner Arbeit bewirken, dass die Bionik in Unternehmen ankommt. Dazu erforsche ich den Prozess und entwickle die Methode weiter, so dass sie leichter verständlich und effizienter einsetzbar wird“, beschreibt die Diplom-Biologin ihre Forschungsarbeit. Seit über fünf Jahren arbeitet sie mit Unternehmen zusammen und lehrt das Fach Bionik in verschiedenen Studiengängen in Deggendorf und in Österreich. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Firmen erhalte ich einen Einblick in die Produktentwicklung und den Innovationsprozess. Wenn Bionik als Problemlösungsstrategie erfolgreich eingesetzt werden soll, ist diese Praxisnähe für mich sehr wichtig. Durch die Lehre kann ich besser verstehen, wie angehende Ingenieure mit der Thematik umgehen. Mich begeistert und motiviert dieses Thema jeden Tag aufs Neue und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht selbst etwas Neues lernen darf.“ Jetzt geht’s nach Paris, London und Kanada Für ihre Forschungsarbeit ist Kristina Wanieck nun den Sommer über an Partner-Universitäten in Paris, London und Guelph, Kanada. „Ich durfte in den letzten Jahren viele angesehene Kollegen aus der ganzen Welt kennenlernen. Umso mehr freut es mich, dass ich nun mit diesen enger zusammenarbeiten und unsere Forschungen verbinden kann.“ Ihr Promotionsvorhaben hat Kristina Wanieck im April 2014 an der TU München begonnen. Ihr Doktorvater, Prof. Dr. Cordt Zollfrank, leitet das Fachgebiet Biogene Polymere und ist mit seinen Laboren am Wissenschaftszentrum in Straubing angesiedelt. Zusammen mit Prof. Dr. Martin Aust, Leiter der Arbeitsgruppe Bionik am Technologie Campus Freyung, betreut er die Arbeiten von Wanieck. Luis Ramirez Camargo arbeitet in der Arbeitsgruppe „Angewandte Energieforschung“. Sein Diplom hat er in Wien an der Universität für Bodenkultur 2012 abgeschlossen. Im gleichen Jahr kam er nach Freyung. Seitdem arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technologie Campus und ist teilweise in Wien wegen seiner Dissertation: „Durch meine Arbeit pendle ich zwischen Freyung und Wien. Das ist zwar manchmal anstrengend, gibtmir aber die Möglichkeit, die Forschungseinrichtungen an beiden Standorten zu nutzen, und es erlaubt mir den permanenten fachlichen Austausch mit Forschern an beidenStandorten“. In seiner Forschungsarbeit befasst sich Luis RamirezCamargo mit räumlich-zeitlicher Modellierung zur Planung dezentraler erneuerbarer Energieerzeugung auf Gemeindeebene: „Ich möchte mit meiner Arbeit zeigen, wie dezentrale Energiesysteme auf Basis von erneuerbaren Energien gestaltetwerden sollen, damit diese in der Lage sind, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“. Für seine Forschungen ist er jetzt für drei Monate nach Argentinien gegangen. „Die Kooperation mit Argentinien gibt es seit 2013. Nun habe ich die Möglichkeit, einige der entwickelten Modelle in ganz neuem Kontext zu testen und dazu beizutragen, dass die Erneuerbare- Energien-Politik im Norden Argentiniens eine bessere Entscheidungsgrundlage hat “, freute sich Ramirez Camargo auf seinen Auslandsaufenthalt. Erste Ergebnisse erzielten die beiden Arbeitsgruppen bereits, Internationale Forschung made in Freyung Erfahrungen sammeln: Doktoranden am Technologie Campus sind zu Forschungszwecken ins Ausland als Prof. Dr. Wolfgang Dorner, wissenschaftlicher Leiter des Technologie Campus Freyung, 2014 für zwei Wochen in Argentinien gewesen war. Danach kamenMitarbeiter aus Argentinien nach Freyung. Auch Stefan Küspert ist Doktorand in der Arbeitsgruppe Angewandte Energieforschung. Im April 2015 hat er seine Forschungen am Lehrstuhl für Anthropogeographie der Uni Passau begonnen. In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt „PUBinPLAN“ geht er der Frage nach, ob sich Akzeptanzprobleme bei Planungsprozessen durch innovative Formen der Bürgerbeteiligung mit neuen Medien lösen lassen. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es vermehrt zu gesellschaftlichen Konflikten bei infrastrukturellen Großprojekten gekommen ist und Bürgerbeteiligung und -integration zu einer zentralen Herausforderung von Planungsprozessen geworden sind. Mit dem Projekt versuchen wir neue Wege der Beteiligung zu installieren,umdie Gefahr einer aufwändigen, aber letztlich überflüssig werdenden Vor- und Detailplanung zu minimieren. Es ist uns ein großes Anliegen, Bürger mit ihrer hohen Regional- und Raumkompetenz in den Planungsprozess rechtzeitig mit einzubinden und diese nicht erst im Nachgang über ein Projekt urteilen zu lassen“, beschreibt Küspert die Intention seiner Arbeit. Zusammen mit dem Lehrstuhl für Anthropogeographie der Universität Passau und den Projektpartnern, wie zum Beispiel dem Amt für ländliche Entwicklung Niederbayern, wird aktuell nach geeigneten Projekten im regionalen, aber auch überregionalen Umfeld der Hochschulen gesucht, um die Stellschrauben unterschiedlicher Planungsprozesse zu erheben. Erfahrungen für Arbeit in Freyung nutzen Für Küspert wird sich zeigen, ob auch er während seiner Arbeit einen Auslandsaufenthalt für sich nutzen wird, die Chancen dafür stehen gut. „Wir unterstützen unsere Doktoranden bestmöglich, insbesondere befürworten wir einen Auslandsaufenthalt. Dieser ist sowohl aus fachlicher Sicht, als auch für die persönliche Entwicklung von besonderemWert.Daher freut es uns, dass unsere Doktoranden so erfolgreich in ihren Gebieten sind und nun diese Chance für sich nutzen können“, beschreibt Karl Kreuß, operativer Leiter am Technologie Campus Freyung, die Unterstützung des Campus. Nach ihren Forschungsaufenthalten wollen Kristina Wanieck und Luis Ramirez Camargo ihre Erfahrungen und Ergebnisse nutzen, umdie Arbeit in Freyung zu stärken. „Wir sehen es auch als unsere Aufgabe, den Standort Freyung in der internationalen Forschung und Entwicklung mit zu positionieren. Umso wichtiger ist es, dass wir den Weg ins Auslandwagen.“
25.08.2015 - pnp

![]() Auftaktveranstaltung an der Technischen Hochschule in Deggendorf
Auftaktveranstaltung an der Technischen Hochschule in Deggendorf
Freyung. Lassen sich Akzeptanzprobleme bei Planungsprozessen durch innovative Formen der Bürgerbeteiligung mit neuen Medien lösen? Um diese Frage geht es bei dem kürzlich gestarteten Projekt PUBinPLAN, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bis August 2017 gefördert wird.
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es vermehrt zu gesellschaftlichen Konflikten bei infrastrukturellen Großprojekten gekommen ist und Bürgerbeteiligung und –integration zu einer zentralen Herausforderung von Planungsprozessen geworden sind. Mit dem Projekt PUBinPLAN wird versucht neue Wege der Beteiligung zu installieren, um die Gefahr einer aufwändigen aber letztlich überflüssig werdenden Vor- und Detailplanung zu minimieren. Ein wesentliches Anliegen von PUBinPLAN ist es daher, die Bürger/inne mit ihrer hohen Regional- und Raumkompetenz in den Planungsprozess rechtzeitig mit einzubeziehen und diese nicht erst im Nachgang über ein Projekt urteilen zu lassen.
In der Auftaktveranstaltung von PUBinPLAN an der Technischen Hochschule in Deggendorf am 07. Mai 2015 waren alle Partner des Projektes zur Information über den geplanten Projektablauf und zu einem konstruktiven Austausch über das weitere Vorgehen geladen. Dank der zahlreichen Teilnahme konnte das Vorhaben aus unterschiedlichsten Blickwinkeln diskutiert werden und konstruktiv an der weiteren Zielsetzung gearbeitet werden. Dabei wurde auch nach geeigneten Projekten gesucht, wie sich die Stellschrauben unterschiedlicher Planungsprozesse erheben lassen und wie sich die Funktionen einer zu entwickelnden Applikation erproben lassen.
sk | 23.06.2015

 Förderverein greift Campus unter die Arme
Förderverein greift Campus unter die Arme
Freyung. Die Arbeit des Technologie Campus Freyung wäre in dieser Form ohne den Förderverein nicht vorstellbar. Darüber ist sich die Arbeitsgruppe „Bionik“ einig, deren Mitarbeiterin Kristina Wanieck bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins einen Jahresrückblick über die geförderten Projekte gab.
So wurde beispielsweise die „Sommerakademie Bionik“, bei der Studenten natur- und ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge einen Einblick in die Bionik erhalten, vom Förderverein finanziert, ebenso der Projekttag mit Schülern des Gymnasiums Freyung und die Vorträge von Dr. Arndt Pechstein und Prof. Herbert Jodlbauer.
Für die Arbeitsgruppe „UAV und Fernerkundung“, die an unbemannten Kleinflugzeugen („Drohnen“) für den Einsatz in der Landwirtschaft arbeitet, hat der Förderverein die Kosten der Anschaffung einer Software übernommen. Auch die Arbeitsgruppe „Angewandte Energieforschung“ wurde vom Förderverein unterstützt. Wanieck dankte dem Förderverein für die Hilfe und das Vertrauen.
Der Kassenbericht von Schatzmeister Josef Demm ergab für das Geschäftsjahr 2014 Einnahmen in Höhe von 5300 Euro, die Ausgaben lagen bei 5200 Euro. Die Kassenprüfer Max Ertl und Otto Weishäupl bescheinigten Demm eine ordentliche Buchführung.
Stellv. Landrätin Helga Weinberger lobte den Technologie Campus als „kompetenten Ansprechpartner vor Ort“ und sprach von einer „sehr guten Entwicklung des Campus“, zu der der Förderverein maßgeblich beigetragen habe. „Der Erfolg gibt uns Recht“, so Weinberger. Die stellv. Landrätin drückte ihre Freude über die Entscheidung aus, dass auch Hauzenberg ein Hochschulstandort werde. Weinberger: „Junge Menschen haben es verdient, in der Region studieren zu dürfen.“
Die Neuwahlen ergaben keine Veränderungen in der Vorstandschaft. Nach der Versammlung referierte Prof. Raimund Förg vom TAZ Spiegelau zum Thema Glas. 23.06.2015 | - mko

 Prof. Förg referierte am Technologie Campus Freyung über Glas
Prof. Förg referierte am Technologie Campus Freyung über Glas
Freyung. Die Zuhörer des Vortrags „Oberflächen, Bauteilentwicklung, Prozessinnovation - Glas, seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und was wir am TAZ Spiegelau alles machen“ staunten nicht schlecht, als Prof. Förg aufzeigte, welche Bedeutung Glas haben kann. Es wird als Alltagsgegenstand wahrgenommen, trägt in sich aber ein Potenzial, das erst beim genauen Hinschauen offenkundig werde.
Förg erklärte anhand der Geschichte und der Materialbeschaffenheit von Glas, dass es sich dabei um einen amorphen Feststoff mit erstaunlichen Eigenschaften handelt. Physikalisch gesehen ist Glas eine unterkühlte Flüssigkeit. So schmilzt Glas bei rund 1400 Grad, bei etwa 1000 Grad ist es formbar und bei Zimmertemperatur ist es fest. Glas ist damit ein wandlungsfähiger Werkstoff, der sich vielseitig einsetzen lässt. „Wir kennen Glas als Verpackungsmaterial für Lebensmittel, wobei es inert und geschmacksneutral ist, in Linsensystemen für Kameras oder Beamer oder als Werkstoff zur Datenübertragung in Glasfaserkabeln.“ Die Einsatzmöglichkeiten und Anwendungen für Glas seien auch aufgrund der Formbarkeit und der gleichzeitigen Formstabilität vielfältig, die innovativsten Ideen von Förg stecken gerade in der Antragsphase für Forschungsprojekte. Insbesondere auch in der Herstellung von leistungsfähigen Computer-Chips könnte Glas in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Zur Bearbeitung von Glas stehen Prof. Förg am TAZ Spiegelau, dessen wissenschaftlicher Leiter er ist, verschiedenste Anlagen zur Verfügung, die es ihm ermöglichen, seine zahlreichen Ideen in Projekten umzusetzen: „Glas ist das Material der Zukunft.“ Prof. Förg ist von seinem Forschungsthema nicht nur selbst begeistert, sondern hat mit seinem mitreißenden Vortrag auch das Interesse der Zuhörer geweckt. Eine rege Diskussion schloss sich dem Vortrag an.
Der Vortrag fand im Rahmen der Reihe „Hochschule Hier und Jetzt“ statt, die der Förderverein Technologie Campus Freyung e.V. regelmäßig durchführt. Wissenschaftler geben dabei einen praxisnahen Einblick in die Forschung an den Campus-Standorten der Technischen Hochschule Deggendorf. 22.06.205 | - pnp

 BürgerEnergieStammtisch informiert über Einsparmöglichkeiten - Heute wieder Treffen
BürgerEnergieStammtisch informiert über Einsparmöglichkeiten - Heute wieder Treffen
Sittenberg/Ruderting. Wichtige Informationen gab es wieder beim vierten BürgerEnergieStammtisch im Gasthaus Billinger in Sittenberg. Unter Moderation von Johannes Schmidt wurden Fragen aufgegriffen und soweit wie möglich vom Experten Josef Pauli fachlich geklärt. Hauptpunkt des Abends war das Thema „Eigenes Handeln leicht gemacht - 500 Euro je Haushalt Einsparungen jährlich ohne Investition und Komfortverlust“.
Eine Frage war, ob es zulässig sei, den Strom der eigenen PV-Anlage via Steckdose selbst zu verbrauchen. Pauli verneinte die Frage, laut „Verband der Elektrotechnik sei die Einspeisung in Endstromkreise unzulässig. Demnach wächst das Risiko von Bränden durch Überlastung von Leitungen und durch die Beeinflussung vorhandener FI-Schalter kann es zu gefährlichen Stromschlägen kommen. Informiert wurde in dem Zusammenahng noch über konkrete Anforderungen und Normen und die Verwendung richtiger Zähler.
Der Hauptvortrag von Pauli zeigte, dass schon mit wenig Aufwand Einsparungen pro Haushalt von bis zu 500 Euro möglich sind, ohne dass es zu einem Komfortverlust kommt oder große Investitionen notwendig sind. Bei einem jährlichen Energieverbrauchsanteil für Strom von 38 Prozent und 60 Prozent für Wärme sind allein durch bewußtes Handeln beim Strom Einsparungen von bis zu 20 Prozent möglich, bei der Wärme 8 Prozent, durch kleininvestive Maßnahmen noch einmal 18 Prozent beim Strom und 7 Prozent bei der Heizung. Heizkennlinieneinstellung, Warmwassertemperatureinstellung, die bedarfsgerechte Einstellung von Zirkulationspumpen und eine Steuerung mittels Heizkreisabschaltung durch Außen- temperaturfühler und über die Thermostate spare viele Euros.
Verblüfft waren die Zuhörer über den Effekt der Außenrollo-Verwendung, der für Wärme- und damit Energieverluste von großer Bedeutung ist. Ausführlich ging Pauli auf Kühlgeräte ein: So sei es immer sparsamer für den Stromverbrauch, Kühlschrank und Gefrierfach auf zwei Geräte zu trennen, statt ein Kombigerät zu kaufen. Die Einsparung mache immerhin ca. ein Drittel aus. Abschließend ging Pauli noch auf den Standby-Verbrauch ein und konnte aufzeigen, dass hier bis zu 295 Euro Einsparungen möglich sind.
Der nächste BürgerEnergieStammtisch im Gasthaus Billinger in Sittenberg findet am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr statt. Die Fragestellungen: Wie wähle ich LED Leuchtmittel richtig aus? Wann ist der Einsatz von LED Leuchtmittel sinnvoll? So kann die Wirtschaftlichkeit an Wunschbeispielen von Zuhörern direkt berechnet werden. Ein Passauer Großhändler wird über LED-Leuchtmitteln informieren. Der BürgerEnergieStammtisch ist keine geschlossene Gesellschaft, sondern für alle Bürger offen. PNP 09.06.2015 | − js

 Forschungsprojekt der Bionik-Arbeitsgruppe am Technologie Campus Freyung und der Parat GmbH
Forschungsprojekt der Bionik-Arbeitsgruppe am Technologie Campus Freyung und der Parat GmbH
Freyung. „Funktionelle Oberflächen durch Selbstorganisation“ - so heißt der offizielle Titel des Forschungsprojektes der Bionik-Arbeitsgruppe am Technologie Campus Freyung und der Parat GmbH & Co. KG, Neureichenau.
Ziel des Projektes ist es, Kunststoffverkleidungen für Nutzfahrzeuge wie Traktoren oder Baumaschinen so herzustellen, dass deren Oberfläche weniger schnell verschmutzt bzw. sich bei Verschmutzung mit weniger Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch sowie geringerem Aufwand säubern lässt.
Innerhalb der Projektlaufzeit von drei Jahren soll eine derartige Oberfläche entwickelt werden. Dazu erforscht das vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie geförderte Projekt zuerst die Grundlagen für solch eine Oberflächenfunktionalisierung. Die Idee dahinter erinnert an das bekannteste Oberflächenphänomen der Natur: das Prinzip der Selbstreinigung am Beispiel der Lotuspflanze.
Durch eine Mikro- und Nano-Strukturierung sowie wasserabweisende Substanzen auf ihrer Oberfläche zeigen Lotusblätter einen Selbstreinigungseffekt, der bereits für zahlreiche technische Anwendungen genutzt wird. Fließendes, abperlendes Wasser nimmt den Schmutz einfach mit und die Oberfläche reinigt sich damit selbst. In der technischen Anwendung dieser Idee gibt es verschiedene Ansätze und Verfahren der Umsetzung.
Beim aktuellen Forschungsprojekt soll sich eine selbstreinigende Oberflächenstruktur durch so genannte migrierende Additive - also innerhalb des Kunststoffes bewegliche Bestandteile - selbst bilden. Diese materialinternen Migrationsmechanismen werden momentan praxisnah erforscht, damit die daran beteiligten Zusatzstoffe bald langfristig den gewünschten Effekt an Oberflächen erzielen können.
Bereits eine ganze Reihe vielversprechender Versuche wurde im Hochschullabor des Deggendorfer Professors Dr. Martin Aust dazu durchgeführt. Derzeit ist die Hälfte des Forschungsprojektes realisiert und die Arbeit geht nun in die letzten beiden Phasen.
Bei der Firma Parat, die unter anderem Kunststoffverkleidungen für Autos und Nutzfahrzeuge herstellt, könnte mit der erforschten Technik eine nachträgliche Verbesserung bestehender Produkte ohne wesentliche Mehrkosten erreicht werden.
Damit zeigt das Projekt anschaulich, wie innovative Forschung industrielle Anwendungen bereichern kann und ist somit ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft durch die Etablierung der Technologie Campus-Standorte.
PNP 13.06.2015


Die Kreisstadt ist mit ihrer Vision „freYOUNG“ bei Programm des Bildungsministeriums dabei
Wie sieht die Stadt von morgen aus? Um diese Frage geht es im Wettbewerb „Zukunftsstadt“, den das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Wissenschaftsjahr 2015 startet. 52 ausgewählte Städte, Gemeinden und Landkreise nehmen bundesweit daran teil und erhalten damit auch Fördergeld, um zukunftsträchtige Ideen in die Tatumzusetzen. Aus Bayern kommen fünf Teilnehmer − und die Stadt Freyung ist einer davon.
Die Nachricht, dass auch Freyung dabei sein wird, hat der Freyunger Konversionsmagager Raimund Pauli nun von Bundesforschungsministerin Johanna Wanka erhalten, die in Dresden die Namen der 52 geförderten Kommunen bekannt gab. Für Freyung heißt das nun: Erst einmal Ideen sammeln.
Zusammenarbeit mit Technologie Campus
Für die Bewerbung um die Aufnahme in das Programm entwickelten Professor Dr. Roland Zink und Anna Marquart vom Technologie Campus Freyung sowie Konversionsmanager Raimund Pauli das Konzept „Mit Jugendlichen den öffentlichen Stadtraum der Zukunft gestalten“, kurz „freYOUNG“. Über den positiven Bescheid sind auch Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich, Professor Dr. Roland Zink und die Projektpartner erfreut. Im Projekt freYOUNG geht es vor allem darum, wie eine lebenswerte Stadt für Jugendliche aussehen könnte. Die Jugendlichen – eine Auswahl an interessierten Schülern der Mittel- und Oberstufe der weiterführenden Schulen von Freyung – sollen hier z.B. in einem Jugendbeirat ihre Ideen einbringen. Die Gründung eines solchen Beirates wirdu.a. von Mitgliedern der Stadtverwaltung, den Schulen, dem Technologie Campus, lokalen Medien und speziell von einem Mentorenteam unterstützt. Dieses wiederum setzt sich aus Vertretern lokaler Vereine und Organisationen zusammen. Seitens der Stadt Freyung hofft man so auf Erkenntnisse für die Stadtplanung: Wie ist die Wahrnehmung der Stadt durch die Jugendlichen? Was wünschen sie sich und was ist am Ende auch umsetzbar? Positiver Nebeneffekt: Wer seine Stadt aktiv mitgestalten kann, der hat auch einen Bezug zur Heimat und bleibt dann auch gerne in der Region. Damit soll das Projekt freYOUNG auch dem demographischen Wandel entgegen wirken. Neun Monate wird das Projekt laufen - es beginnt voraussichtlich im Juli 2015 und endet Ende März 2016.
DAS PROJEKT
Der Wettbewerb „Zukunftsstadt“ soll zeigen, wie Bürger und Forschung dazu beitragen können, Städte lebenswert zu gestalten. 1,75 Millionen Euro stellt das BMBF dafür insgesamt bereit. Bundesweit haben sich 168 Städte, Gemeinden und Landkreise für die Teilnahme beworben. 52 Kommunen, darunter auch Freyung, wurden von einer Expertenjury ausgewählt. In der ersten Phase des Wettbewerbs werden die Kommunen im Bürgerbeteiligungsprozess eine Vision für ihre Kommune entwickeln und Handlungs- bzw. Umsetzungsvorschläge erarbeiten. In der zweiten Phase ab 2016 prüfen bis zu 20 ausgewählte Kommunen diese Vorstellungen wissenschaftlich und erarbeiten ein umsetzungsreifes Konzept. In der dritten Phase ab 2018 werden schließlich bis zu acht ausgewählte Kommunen ihre Ideen in sogenannten „Reallaboren“ in die Praxis umsetzen. Der Wettbewerb „Zukunftsstadt“ startet im Rahmen des Wissenschaftsjahres – 2015 Zukunftsstadt, einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD).
04.05.2015 | − pnp/löw

 Spannende Vorträge heute beim "Tag der Forschung" an der TH Deggendorf
Spannende Vorträge heute beim "Tag der Forschung" an der TH Deggendorf
Von der Natur lernen, um die Technik zu verbessern: Das steckt hinter dem Forschungsgebiet Bionik, mit dem sich an der Technischen Hochschule Deggendorf die Arbeitsgruppe Bionik befasst. Welchen Nutzen man aus dieser Forschung für die Produktoptimierung ziehen kann, erklärt Diplom-Biologin Kristina Wanieck, die seit 2009 am Technologiecampus Freyung in Sachen Bionik forscht, heute in einem Kurzvortrag anlässlich des "Tags der Forschung".
Das Forschungsprojekt "FOSorg − Funktionelle Oberflächen durch Selbstorganisation – Easy to clean-Oberflächen" befasst sich mit
diesem Thema. Der Titel klingt erstmal schwierig. Tatsächlich geht es aber um einen relativ einfachen Sachverhalt. Wie muss eine Oberfläche gestaltet sein, damit sie kaum Schmutz annimmt oder sich dieser leicht entfernen lässt? "Aus der Natur ist bekannt, dass unter anderem Pflanzen wie Lotus, Maiglöckchen, Kohl und Brunnenkresse einen selbstreinigenden Effekt zeigen. Dieser wird allgemein als 'Lotuseffekt' bezeichnet", sagt Kristina Wanieck. Um einen solchen Effekt von der Biologie in die Technik zu übertragen, bedarf es intensiver Forschungsarbeit.
Dabei befasst sich das Projekt mit Polymeren – Kunststoffen also. "Es geht darum, zu erforschen, wie sich Kunststoffe so verändern lassen, dass durch Selbstorganisation an der Oberfläche dieser leichtreinigende Effekt erzielt wird", erklärt die Diplom-Biologin. Die Ergebnisse sollen auch ermöglichen, dass dieser Effekt rohstoffschonend und preiswert erzeugt werden kann. Anwendung sollen diese Ergebnisse in der Automobilbranche finden.
Der Anstoß zu dem Forschungsprojekt kam aus der Industrie, gemeinsam wurde dann das Konzept entwickelt. Was genau alles dahintersteckt, wie geforscht wird und was man mit den Ergebnissen anfangen kann, das wird ebenfalls beim Kurzvortrag am Tag der Forschung erläutert. Dabei reiht sich heute, Donnerstag, ab 12.30 Uhr im Josef-Rädlinger-Hörsaal ein Thema an das nächste – neben der Bionik auch über Mobilitätskonzepten der Zukunft, Energie und Nachhaltigkeit, Nanotechnologie und Neue Werkstoffe sowie im Bereich Industrie 4.0. Nach jedem Vortrag gibt es Gelegenheit, Fragen zu stellen und über das Gehörte zu diskutieren.
05.03.2015 | PNP−sas

Technologiecampus Freyung: Leiter zieht positive Bilanz und hofft auf weitereGelder − Idee: Forschungs-Gesellschaft
Wie steht es um den Technologie Campus in Freyung? Was tat sich im Verlauf des Jahres? Und wie gestaltet sich die Zukunft? Auf diese Fragen ging in der jüngsten Kreistagssitzung Campusleiter Prof. Dr. Wolfgang Dorner ein.
Laut seinen Ausführungen seien derzeit über zehn Studenten am Campus in Freyung, die dort an ihren Abschlussarbeiten schreiben oder ein Praktikum absolvieren. Mittlerweile habe sich der Campus gut etabliert und wenn er, Dorner, unterwegs sei, treffe er immer wieder ehemalige Studierende des TCF wieder. Die Einnahmenseite (durch private Projekte, öffentliche Hand, etc.) stelle „eine solide Basis“ dar,mit der man in den kommenden Jahren gut weiter arbeiten könne. Auch sei die Entwicklung des Campus im Vergleich zu anderen Campi äußerst positiv, stelle sich konstant dar und zeichne sich durch eine sehr gute Vernetzung in der Industrie und bei den Betrieben aus.
„Campus gibt Region Selbstbewusstsein“
Auch zum Thema Grundfinanzierung äußerte sich Dorner: Er begrüßte die guten Nachrichten aus München: Die Bayerische Staatsregierung hat vor einigen Wochen beschlossen, im Doppelhaushalt 2015/16 die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass erfolgreichen Technologietransferzentren auf Dauer eine staatliche Grundfinanzierung gewährt werden kann. Für den Freyunger Campus soll es rund 200 000 Euro geben. „Damit kann man gut weiter arbeiten“, so Dorner. Zuvor war Beschlusslage, dass den Technologie Campi nur eine fünfjährige Anschubfinanzierung gewährt wird und sie sich dann aus eigener Kraft weiterbringen müssen. Die Stadt Freyung unterstützte in den vergangenen fünf Jahren die Ansiedlung der Außenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf mit einem jährlichen Zuschuss von 125 000 Euro.
„Wo wollen wir nun hin mit der Grundfinanzierung?“ Diese Frage stellte Dorner selbst − und gab auch die Antwort. Zum einen seien die 200 000 Euronoch nicht das, was auch andere Forschungszentren bekommen. Er, Dorner, wolle, dass dem Landkreis eine noch größere Anerkennung zukomme und dies sich auch finanziell zeige. Auch äußerte der Campusleiter einen besonderen Wunsch: Ihm schwebe vor, eine Fraunhoferähnliche Gesellschaft zu gründen − „beispielsweise eine Oskar von Miller Gesellschaft“. Die Fraunhofer-Gesellschaft ist nach eigenen Angaben die größte Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa.
Im Hinblick auf die Zukunft des Campus sagte Dorner: „Wir wollen ihn auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand halten und ihn sukzessive und in kleinen Schritten ausbauen.“ Auch lud Dorner die anwesenden Politiker ein, sich einmal ein Bild vor Ort zu machen und eine Führung durch die Campus-Räume und Laborewahrzunehmen.
Landrat Sebastian Gruber betonte nach Dorners Bericht, dass der Campus der Region „Selbstbewusstsein und Zukunft“ gegeben habe. Dass das Thema Grundfinanzierung nun nach langer Zeit geklärt werden konnte, sei auch den hiesigen Politikern zu verdanken, die sich stets für die Sache eingesetzt hatten. Freyungs Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich zeigte sich ebenfalls zufrieden und sagte: „Die Dezentralisierungsstrategie bei Forschungseinrichtungen hat funktioniert.“ Die Grundfinanzierung stabilisiere nun die Forschungseinrichtungen im Bayerischen Wald, so Heinrich, der auch einen besonderen Dank an Dorner für dessen „überdurchschnittliches Engagement“ aussprach.
In der Sitzung aber auch bei vorherigen Diskussionen, wie etwa im Kreisausschuss, war zudem von verschiedenen FRGPolitikern gefordert worden, dass man in Sachen Campi-Finanzierung die Kommunen mehr aus der Pflicht nehmen müsse. Deshalb begrüße man die Grundfinanzierung aus München nun sehr. Kreisrat und Freie-Wähler-MdL Alexander Muthmann hatte jedoch bereits im Vorfeld der Sitzung in einer Mitteilung angemerkt, „dass die derzeit in Aussicht gestellten Mittel nicht ausreichen“ würden. Der Landkreis Freyung- Grafenau zum Beispiel habe für die Zentren in Freyung, Spiegelau und Grafenau im Jahr 2013 insgesamt 725 000 Euro gezahlt, in Freyung und Spiegelau leisteten Stadt und Gemeinde jeweils weitere 150 000 Euro. Muthmann: „Die 210 000 Euro reichen bei weitem nicht aus. Hier muss die Staatsregierung noch nachbessern und für die gesamten Kosten aufkommen.“
Quelle: Passauer Neue Presse vom 11.12.2014
Autorin/Foto: Jennifer Jahns


Mit PV-Anlagen und Nahwärmenetzen könnte Zenting energieautark werden
Als „wesentlichen Schritt für die Zukunft“ sah Bürgermeister Leopold Ritzinger die Fertigstellung des Energiekonzepts für die Gemeinde an, das nun der Öfffentlichkeit vorgestellt wurde. Damit werde ein Umsetzungsprozess in Gang gesetzt, der Kommune und Bevölkerung über Jahre oder gar Jahrzehnte in Beschlag nehmen werde. Zunächst gelte es nun, die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren.
Zur Vorstellung des Energiekonzepts, das im Rahmen des Programms „100 energieautarke Gemeinden“ erstellt worden sei, begrüßte der Bürgermeister neben den Protagonisten Dipl. Ing. Josef Pauli vom Technologiecampus Freyung, Thomas Mader und Matthias Obermeier vom Ing.Büro Nigl + Mader, Röhrnbach, besonders Dr. Thomas Kerscher vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) als „Finanzier“ sowie Professor Dr. Wolfgang Dorner von der Technischen Hochschule Deggendorf als Referenten.
„Die Energiewende gestalten. Was bringt’s? Was ist zu tun?“, auf diesen kurzen Nenner brachte Pauli den Sinn eines Energienutzungskonzepts Ausgehend von der gegenwärtigen Situation, die einen hohen CO2-Emissionswert proKopf ausweise, wurden Strategien entwickelt, um die Wertschöpfung möglichst in der Gemeinde bzw. Region zu halten und Wege zu einer energieautarken Gemeinde aufzuzeigen.
Allein aus dem ermittelten Wärmeverbrauch von knapp 19 200 Megawatt, der derzeit durch fossile Energieträger gedeckt werde, sei eine Wertschöpfung von rund einer Million Euromöglich, so Pauli. In Ster Holz ausgedrückt – auf Nachfrage von Heike Dülfer – seien dazu jährlich 13 000 Ster notwendig. In Zenting könne man allerdings lediglich ein Drittel aus nachwachsendem Holz decken. Da davon rund 82,5 Prozent von den privaten Haushalten verbraucht werde, sei es wohl das „größte Problem“, wie diese für eine Energiewende mobilisiert werden können. Darin sehe er vor allem eine Aufgabe der Gemeinde, sagte Josef Pauli.
Die Strategie, die Gemeinde zum Wärmeselbstversorger zu machen, sei „zwar nur ganz knapp, aber möglich“, war er überzeugt. Insbesondere durch Einsparungen und Sanierungen sei, neben dem Einsatz von Biomasse und Solarthermie, ein Großteil der Wärme zu generieren. Die Frage, die sich Gebäudeeigentümer stellen müssten, ist: Kann ich es mir leisten, nicht zu sanieren? Dasselbe gelte für den Stromverbrauch. Wenn nur jeder zweite Hausbesitzer eine PV-Anlage installiere, sei eine Selbstversorgung möglich, rechnete der Diplom-Ingenieur vor – „und Dachflächen sind genug vorhanden“.
Prof. Dorner betrachtete anschließend die „Energiewende im Kontext unserer Zeit“. Diese werde von den Medien bereits totgesagt. Die Verunsicherung sei groß. „War nun alles für die Katz'?“, fragte er. Für die Kommunen seien jedoch zwei Aspekte relevant: Was ich tun kann,sollte ich tun, wenn es gesellschaftlich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei Planungen sollte man konsequent nach vorne denken. Dadurch könne man auf sich ändernde Situationen rechtzeitig reagieren, Fehlentwicklungen vermeiden und im Bedarfsfall steuernd eingreifen. „Die Kommunen haben es selbst in der Hand, vorausschauend zu planen und selber zu handeln“, betonte Dorner.
Wie also könnte nun die Umsetzung aussehen, welche konkreten Maßnahmen werden vorgeschlagen? Dazu gab Matthias Obermeier an drei Beispielen nähere Auskunft: PV-Freiflächenanlage, Nahwärmenetze in verschiedenen Orten, verbesserte Heizsysteme – so könne es gehen. Wenn sich auch manches Projekt anfangs nicht rechne, sei doch eine Rentabilität auf lange Sicht gegeben. Die Nutzungsdauer der Anlagen gehe weit über die Tilgungszeit des eingesetzten Kapitals hinaus.
Das Energiekonzept sehe dazu einen Maßnahmenkatalog vor, so Josef Pauli, der einzelne „Leuchtturmprojekte“, wie etwa die vorgenannten, hervor hebe. Als „ein Muss“ sehe er es deshalb an, einen Energiebeauftragten zu bestellen, der den Prozess am Laufen halte und immer wieder anschiebe. Weiter sollte sich die Gemeinde Ziele setzen und auch die Gründung einer kommunalen Gesellschaft zur Wärme- und Stromvermarktung sollte angedacht werden. Um in konkrete Planungen einsteigen zu können, sollte aber vor allem eine Abfrage aller Haushalte zu deren Wärme- und Strombedarf erfolgen. Ebenso sei ein gemeinsamer Energieeinkauf von Gewerbe und Landwirtschaft langfristig der günstigereWeg.
Der Bürger sollte ersehen, dass er einen Nutzen daraus hat, dann werde er sich auch leichter mit der Energiewende identifizieren, sagte Pauli und bedankte sich abschließend „für Ihr Vertrauen in uns“.
Bürgermeister Ritzinger sah im Energiekonzept eine „tolle Inspiration“. Es gelte nun die Bevölkerung zu mobilisieren, denn „es geht jeden Einzelnen an“. Neben der Bewusstseinsbildung können aufgezeigte Einsparpotenziale schnelle Erfolge zeitigen. An den längerfristigen Maßnahmen werde die Gemeinde dran bleiben. Das Energiekonzept dürfe nicht zur Makulatur werden, sondern fordere Bürger und Kommune gleichermaßen. „Ein wesentlicher Schritt in die Zukunft“, betonte Ritzinger abschließend.
Quelle: Passauer Neue Presse vom 27.11.2014
Autor/Foto: Thurnreiter

Die Stadt Freyung und der Landkreis Freyung-Grafenau haben künftig mehr Geld in der Kasse.
Die Bayerische Staatsregierung übernimmt nämlich wie geplant die Grundfinanzierung der Technologie Campi. Laut Freyung-Grafenaus Landrat Sebastian Gruber bedeutet dieser Entschluss eine Entlastung von 125.000 Euro jährlich. 2009 wurde in Freyung der Technologie Campus als Außenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf eröffnet. Die Bayerische Staatsregierung hatte damals verlangt, dass die Kommunen fünf Jahre lang eine „Anschubfinanzierung“ leisten müssen. Nach fünf Jahren– so die nun eingehaltene Zusage – sollte der Freistaat die Grundfinanzierung übernehmen. Auch die Campi in Spiegelau und Grafenau werden in ein paar Jahren damit rechnen können.
Quelle: TRP1


CSU-Kreisvorstandssitzung in Freyung − MdB Barthl Kalb berichtet über aktuelle Themen
„Die Bayerische Staatsregierung hat Wort gehalten: Mit der Übernahme der Grundfinanzierung für die Technologie Campi in Bayern werden die Kommunen im Landkreis Freyung- Grafenau deutlich entlastet“, stellte CSU-Kreisvorsitzender und Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrichbei einer Kreisvorstandssitzung der CSU in Freyung fest. Ein weiterer Schwerpunkt der Vorstandssitzung war ein Bericht von MdB Bartholomäus Kalb.
Im Jahr 2009, als in Freyung und Teisnach die ersten Außenstellen der Technischen Hochschule Deggendorf eröffnet wurden, lautete die Zusage: Die Kommunen müssen für die ersten fünf Jahre eine Anschubfinanzierung leisten. Im Anschluss werden sie aus der Zahlungsverpflichtung entlassen. Nach dem Beschluss des Bayerischen Kabinetts, im Doppelhaushalt 2015/2016 Mittel für die Grundfinanzierung der Technologie Campi in Bayern einzuführen, werden zuerst die Stadt Freyung und die Gemeinde Teisnach in den Genuss dieser Grundförderung kommen.
„Für die Stadt Freyung und den Landkreis Freyung-Grafenau bedeutet dieser Beschluss eine Entlastung von jährlich jeweils 125 000 Euro“, betonte Landrat Sebastian Gruber. Die hohen Zahlen sowohl bei den Mitarbeitern, als auch bei den Forschungsaufträgen in Freyung belegen, dass das Konzept, Forschungseinrichtungen zu dezentralisieren, völlig aufgegangen sei. „Mehr als hundert direkt mit dem Campus in Zusammenhang stehenden Arbeitsplätze sprechen hier eine ganz deutliche Sprache“, unterstrich Dr. Olaf Heinrich weiter. Der CSU-Kreisvorstand dankte sowohl MdL Max Gibis, als auch Staatssekretär Bernd Sibler für den kontinuierlichen Einsatz für die Übernahme der Grundfinanzierung durch den Freistaat.
Während der Technologie Campus in Spiegelau bereits drei Jahre existiert, wird der Technologie Campus in Grafenau noch mehr als vier Jahre Zeit haben, um sich mit Forschungsaufträgen weitestgehend selbst zu finanzieren. Nach der Beschlusslage des Freistaates können dann beide Standorte ebenfalls mit der Übernahme der Grundfinanzierung rechnen, was sowohl Spiegelau, als auch die Stadt Grafenau finanziell entlasten wird.
Der langjähriges Bundestagsabgeordnete Bartholomäus Kalb, der seit 1987 den Wahlkreis Deggendorf / Freyung-Grafenau vertritt, berichtete über die Hintergründe der kriegerischen Auseinandersetzung im Irak. Er unterstrich dabei, dass „religiöser Fanatismus gepaart mit einer nie dagewesenen, professionellen Öffentlichkeitsarbeit des Islamischen Staats die Weltgemeinschaft vor große Herausforderungen stellt“. Auch sei die Terrororganisation IS mit großen finanziellen Mitteln ausgestattet und außergewöhnlich brutal in ihrer Vorgehensweise.
Zur aktuellen Diskussion über die mögliche Reduzierung der kalten Progression merkte der stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages an: „Ich unterstütze die Linie von Ministerpräsident Horst Seehofer, der vorgeschlagen hat, alle zwei bis drei Jahre die Folgen der kalten Progression zu bewerten. Viel wichtiger erscheint mir jedoch im Moment, dass wir im Bundeshaushalt zusätzliche Mittel für den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur mobilisieren können. Gerade wer sich die Situation auf der A3 zwischen Passau und Regensburg ansieht, der sieht den dringenden Handlungsbedarf“.
MdB Kalb betonte weiter, dass bei einer zurückgehenden Zahl von Menschen im Erwerbsleben die Produktivität in Deutschland deutlich steigen müsse, um den Lebensstandard zu erhalten. „Dafür ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur von zentraler Bedeutung“.
Quelle: Deggendorfer Zeitung vom 28.10.2014

Euregio plant Sprachoffensive in FRG − Projekt dem Kultusstaatssekretär Sibler vorgestellt − TC als Vorbild
Sprache soll verbinden − gerade in Grenzregionen muss sie das auch. Sprache bildet das Fundament von Kommunikation und ist daher nicht nur für die Verständigung der Gesellschaft, sondern auch für die Wirtschaft wichtig. In Tschechien sprechen neben ihrer Muttersprache die meisten Menschen noch Deutsch, nicht wie zu vermuten wäre Englisch. Aber: Der Trend bewegt sich weg von Deutsch, hin zu Englisch. Deswegen plant die Euregio ein "Pilotprojekt" in Ost-Bayern und stellte dies nun Kultusstaatssekretär Bernd Sibler bei einem Besuch in Freyung vor.
"Es ist ein Thema, das auf den Nägeln brennt", sagt Kaspar Sammer, Geschäftsführer der Euregio, "denn Sprachbarrieren stellen in der Region eine große Hürde dar."
Das liegt aber nicht zwingend an unserem östlichen Nachbarland. Denn hier sprechen viele Deutsch, zumindest im Ansatz. Jeder Zweite zeigt sich dort gewillt, Deutsch zu lernen. Zahlen, von denen der ostbayerische Raum in umgekehrter Richtung weit entfernt ist. Deswegen fällt zunehmend auf, dass Deutsche und Tschechen sich auf Englisch austauschen. Dem soll nun entgegnet werden. So plant die Euregio bereits im Kindergarten die Sprache Tschechisch zu vermitteln. "Es passiert ein wenig was in den Schulen. Aber alles nur sporadisch. Wir möchten eine möglichst durchgängige Sprachausbildung", kündigt Sammer an. Diese soll im Kindergarten beginnen und so die Basis für leichteres Lernen in der Schule legen. "Sind die Grundkenntnisse erst vorhanden, lernt es sich leichter und es kommt zu keiner Überforderung", sagt Sammer und zeigt sich überzeugt davon, dass Sprache verbindet − gesellschaftlich und wirtschaftlich. "Das Projekt ’Ostbayern − das Sprachenland’ ist ein Schlüsselprojekt!"
Der Euregio-Vorsitzende und Landrat Sebastian Gruber erkennt ebenso das Potenzial, das eine erweiterte Sprachkompetenz mit sich bringt. "Für mich persönlich ist es eine Herzensangelegenheit. Für die zukünftigen wirtschaftlichen Verbindungen wird die sprachliche Fortbildung enorm wichtig werden."
Vorbild Niederösterreich
Den Vorreiter sehen Sammer und Gruber im Gebiet Niederösterreich. Seit Jahren werden die Kinder hier wahlweise in Tschechisch, Ungarisch oder Slowenisch unterrichtet − von klein auf. "Die Art und Weise, wie dort Sprachausbildung betrieben wird, birgt für unsere Region ein tolles Angebot", sagt Sebastian Gruber. Auch Kaspar Sammer war begeistert vom österreichischen Konzept und besorgte sich gleich ein paar Lernmaterialen zur Veranschaulichung, die er Staatssekretär Bernd Sibler präsentierte.
Sibler seien ähnliche Projekte bekannt, die auch Erfolg zeigten, wie zum Beispiel in Weiden/Amberg oder Cham in der Oberpfalz. "Mich begleitet das Thema Tschechisch. Dass es keine Massenbewegung wird, ist mir klar", sagt der Staatssekretär. Dennoch erkenne er das Potenzial, das Sprache mit sich bringt. Um "mehr Interesse zu wecken", so Sibler, sei es nun nötig, ein detailliertes Konzept einzureichen, auch um Fördermittel beantragen zu können.
Die Finanzierung der nötigen 500000 Euro könnte zu fast 80 Prozent aus europäischen Mitteln geschehen, die restlichen 20 Prozent möchte Euregio-Geschäftsführer Sammer aufteilen. Alleine könne er sie nicht tragen und bittet daher um Landesmittel.
Einen Beweis für die völkerverbindende Wirkung von Sprache liefert der Technologie-Campus in Freyung, der seit mittlerweile fünf Jahren hier forscht und entwickelt. "Nach dieser Zeit steht fest: Das damalige Projekt war ein Riesenschritt für die Stadt und die Regionalentwicklung", sagt Sebastian Gruber. Auch emotional werte der Campus Freyung und den Landkreis auf. "Er bildet Fachkräfte aus und behält sie in der Region", ergänzt Bernd Sibler.
Der Erfolg basiert unter anderem auch auf Sprachen: Campusleiter Prof. Dr. Wolfgang Dorner gibt sich umtriebig, gastiert des Öfteren in der tschechischen Nachbarschaft, um Messen zu besuchen und Kooperationen zu pflegen. "An ihm erkennt man, wie wichtig Sprachausbildung sein kann", sagt Landrat Gruber und spielt auf das fließende Tschechisch Dorners an.
Auch wenn es noch keine Zusage gab − Sammer und Gruber war es wichtig, die Idee "ins Ministerium eingespeist" zu haben. In dessen Händen liegt es nun größtenteils, ob "Ostbayern − das Sprachenland" Realität wird.

Industrie 4.0 beschreibt die so genannte vierte Industrielle Revolution, in der Informations- und Kommunikationstechnolgien Produkte und Maschinen intelligent werden lassen und diese untereinander vernetzen. Prof. Dr. Herbert Jodlbauer wird mit seinem Vortrag allgemeinverständlich zeigen, was sich hinter Industrie 4.0 verbirgt und wie die Natur mit ihren erfolgreichen Prinzipien Vorbild sein kann, um der zunehmenden Komplexität zu begegnen. Die Veranstaltung ist öffentlich und Sie sind herzlich eingeladen!
WANN: Donnerstag, 18. September 2014, 19:00 Uhr
Prof. (FH) Dr. Herbert Jodlbauer
FH Oberösterreich, Standort Steyr
WO: Technologie Campus Freyung
Grafenauer Str. 22
94078 Freyung
Multimediaraum, EG


Große Erleichterung bei FRG-Politkern: Staatsregierung beschließt Grundfinanzierung für Technologie Campi
Mit großer Erleichterung haben die Kommunalpolitiker im Landkreis die Nachricht aus München aufgenommen: Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, im Doppelhaushalt 2015/16 die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass erfolgreichen Technologietransferzentren auf Dauer eine staatliche Grundfinanzierung gewährt werden kann, wie Wissenschaftsstaatssekretär Bernd Sibler mitteilte.
Damit geht zumindest teilweise eine Forderung in Erfüllung, die in der Region schon lange erhoben wird − nämlich dass nicht finanzschwache Bayerwaldkommunendie eigentlich „staatliche“ Aufgabe der Hochschulfinanzierung mittragen müssen. Bislang war Beschlusslage, dass den Technologie Campi nur eine fünfjährige Anschubfinanzierung gewährt wird und sie sich dann aus eigener Kraft weiterbringen müssen.
„Dieser Schritt der Staatsregierung ist richtig und für den Landkreis Freyung-Grafenau mit seinen drei Forschungsstandorten sehr wichtig“, kommentiert Landrat Sebastian Gruber die gute Nachricht aus München. „Unsere Technologiecampi laufen gut und sind mittlerweile in den Bereichen Wissenschaft und Technologie wichtige Partner für unsere Unternehmen. Diese Entscheidung trägt unseren Forderungen aus der Region Rechnung, die Staatsregierung hat ihre Verantwortung erkannt und nimmt sie wahr.“ Die Übernahme der Grundfinanzierung aus dem Staatshaushalt sei zudem eine wichtige finanzielle Entlastung. „Seit 2009 steht der Technologie Campus in der Kreisstadt Freyung für qualifizierte Arbeitsplätze sowie erfolgreichen Know How-Transfer zu den Betrieben in der Region“, sagt Freyungs Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich. Die Stadt Freyung unterstützte in den vergangenen fünf Jahren die Ansiedlung der Außenstelle der Technischen Hochschule Deggendorf mit einem jährlichen Zuschuss von 125 000 Euro.
„Die Bayerische Staatsregierung hat bei der Kabinettssitzung beschlossen, eine Grundfinanzierung für die Technologiecampi in den Staatshaushalt 2015/16 aufzunehmen. Damit fällt mir ein großer Stein von Herzen“, kommentiert der Freyunger Bürgermeister die Entscheidung. „Die Finanzierung für die Campi war lediglich für fünf Jahre gesichert. Wir haben alle auf ein positives Signal für die erfolgreichen Forschungseinrichtungen im ländlichen Raum gehofft − dieses ist nun gesetzt worden. Die Bestandssicherung der Technologiecampi bedeutet Planungssicherheit für die kooperierenden Unternehmen in der Region und entlastet die örtlichen Kommunen, die bisher trotz angespannter Haushaltslage die Anschubfinanzierung stemmen mussten. Der Beschluss ist ein sehr, sehr positives Signal für die Region“, so Heinrich.
Er verweist darauf, dass durch die Eröffnung des Technologie Transferzentrums im Jahre 2009 „ein spürbarer, positiver Ruck durch die Stadt Freyung“ gegangen sei. Es seien Unternehmen angesiedelt und Arbeitsplätze geschaffen worden, die zu einem erkennbaren Aufschwung in der Kreisstadt beigetragen hätten. „Dass die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden kann und unsere Wissenschaftler langfristig bleiben werden, das ist ein weiterer Impuls für Freyung und die gesamte Region“, freut sich Heinrich.
Ganz besonders betroffen von der Entscheidung sei laut Dr. Heinrich der Landkreis Freyung- Grafenau: Hier befinden sich mit Freyung, Spiegelau und Grafenau drei Transferzentren - mehr als in jedem anderen Landkreis Bayerns. „Gerade für unseren Landkreis stellt die Entscheidung für eine Grundfinanzierung aus dem Staatshaushalt eine wichtige finanzielle Entlastung dar, die uns sehr gut tut.“
„Das ist eine gute Geschichte“, so Grafenaus Bürgermeister Max Niedermeier auf Anfrage des Grafenauer Anzeiger. So werde nicht alles auf die Kommunen abgeschoben. „Der Haushalt der Stadt Grafenau wird dadurch merklich entlastet“, und zudem sicher auch der Haushalt der Hochschule Deggendorf, die sich dann auf ihre Kernaufgabe, nämlich die Forschung, konzentrieren könne.
„Ich bin glücklich und dankbar zugleich, dass die staatliche Grundfinanzierung der Technologiezentren der Region, welche bereits der Finanzminister Dr. Markus Söder bereits bei seinem Besuch in Spiegelau am 10. Februar 2014 in Aussicht gestellt hatte, nunmehr vom Bayerischen Kabinett beschlossen wurde“, sagt Spiegelaus Bürgermeister Karlheinz Roth. „Unsere gemeinsamen Bemühungen in dieser Sache haben sich damit gelohnt. Durch die Gewährung einer staatlichen Grundfinanzierung nach dem Ablauf der Anschubfinanzierung wird eine spürbare und zugleich dringend notwendige Entlastung unseres Gemeindehaushalts erreicht „Diese Entscheidung tut uns sehr gut Große Erleichterung bei FRG-Politkern: Staatsregierung beschließt Grundfinanzierung für Technologie Campi werden. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Staatsminister Helmut Brunner, unserem örtlichen Landtagsabgeordneten Max Gibis und dem Bezirkstagspräsidenten Dr. Olaf Heinrich, welche die Bemühungen der betroffenen Gemeinden in den letzten Wochen und Monaten mit großem Engagement unterstützt haben.“
Auf verhaltene Freude stößt die Nachricht, dass im Doppelhaushalt 2015/2016 Mittel für die Technologietransferzentren geschaffen werden sollen, bei MdL Alexander Muthmann (Freie Wähler): „Sollte unser jahrelanges Bohren nun zu einem Einlenken der Staatsregierung geführt haben, ist dies gut. Hätten wir das Thema nicht immer wieder aufgegriffen, wäre es sicher nicht so weit gekommen.“
Zufrieden stellen könne die Aussage von Staatssekretär Bernd Sibler die betroffenen Kommunen, Landkreise und Technologiecampi jedoch nicht. „Die Kritik am System bleibt weiterhin.“ Denn nur mit einer „staatlichen Grundfinanzierung“ sei es laut Muthmann nicht getan. „Es kann nicht darum gehen, nur eine Basis zu finden, damit ein Teil der kommunalen Lasten übernommen wird.“ Vielmehr müsse der Staat die Gesamtfinanzierung der Technologiezentren tragen. „Laut Bayerischer Verfassung ist die Einrichtung und Verwaltung der Hochschulen Sache des Staates. Dies muss auch für die Technologiecampi gelten – und diese Forderung muss auch aufrechterhalten werden.“
Es kann laut Muthmann nicht länger hingenommen werden, dass die Kommunen und Landkreise bei der Finanzierung der Campi in die Pflicht genommen werden. „Für den Landkreis Freyung-Grafenau wird derzeit ein Konsolidierungskonzept für den eigenen Haushalt erstellt. Wie sollen in so einer angespannten Lage noch freie Gelder für Technologiecampi gefunden werden?“ Eine weitere Zahl: Die Stadt Grafenau muss den Bau des Technologiecampi mit drei Millionen Euromitfinanzieren. „Das Geld muss erst einmal aufgebracht werden.“
Die Freie Wähler-Landtagsfraktion habe im März dieses Jahres einen Antrag gestellt, dass der Nachtragshaushalt 2014 geändert wird und fünf Millionen Euro zur Finanzierung der Gebäude der Technologiecampi eingeplant werden. Er sei von der CSU abgelehnt worden.
Quelle: Passauer Neue Presse vom 8.8.2014

 Wagensonnriegel: Bürgermeister Roth spricht von offenem Prozess– Bevölkerung durch Informationen einbinden
Wagensonnriegel: Bürgermeister Roth spricht von offenem Prozess– Bevölkerung durch Informationen einbinden
„Windenergie in Bürgerhand“, so hieß die Infoveranstaltung der Bürgerenergie FRG eG, die in Klingenbrunn stattfand. Das Interesse war groß, es war ein Riesenerfolg für die Veranstalter und zugleich informativ für die mehr als 100 gekommenen Zuhörer aus dem ganzen Landkreis FRG, aus den Gemeinden Kirchdorf und Rinchnach.
Der aktuelle Anlass hierzu waren bekannt gewordene Planungen für eine Windkraftanlage am Wagensonnriegel, die der Regionale Planungsverband Donau- Wald bereits veröffentlicht hat. Für ein solches Projekt hatten bereits die Stadtwerke München zu einer Infoveranstaltung nach Kirchdorf i. Wald eingeladen, unter anderem mit den Bürgermeistern aus Frauenau, Rinchnach und Kirchdorf i. Wald. Der Bürgermeister aus Spiegelau Karl-Heinz Roth war dazu nicht geladen.
In seinem Grußwort deutete der auch an, dass er an ein behutsames Herangehen mit Bedacht und unter Einbindung der Bürger seiner Gemeinde diesem Vorhaben gegenüberstehen werde.
Der Vorstandsvorsitzende der „Bürgerenergie“ Hans Madl Deinhart erläuterte zu Beginn, warum dieses Thema für seine Organisation so wichtig sei. Der Atomausstieg sei beschlossen, und auch der Strom aus Kohle belastet die Umwelt. So müsse neben Energieeinsparung und Effizienzsteigerung die Nutzung erneuerbarer Energie in unserer Region Vorrang erhalten. Zielsetzung sei also eine dezentrale, eigenverantwortliche, demokratische und umweltverträgliche Energiegewinnung, „die auch unsereRegion stärken wird“.
Thomas Mader (Vorstandsmitglied) sprach über die Gegebenheiten, wie sie sich als Windenergie Wagensonnriegel zur Zeit darstellen. Der Wagensonnriegel (959 Meter) ist ein Höhenzug zwischen den Gemeinden Klingenbrunn, Frauenau, Rinchnach und Kirchdorf i. Wald. Die zu bebauende Fläche liege im Hoheitsgebiet der Bayerischen Staatsforsten. Der Windparkbereich wäre von Klingenbrunn aus durch bereits ausgebaute Wege gut erreichbar und es wären keine Wasserquellen in unmittelbarer Nähe. Der Abstandsradius von 800 Meter, bzw. 2000 Meter würde keine bebaute Fläche berühren.
Hans Beringer, Mitglied des Vorstandes der „Bürgerenergie“, erinnerte eindringlich an unsere Verantwortung für die Zukunft, denn es sei evident, dass der Klimawandel und die Erschöpfung konventioneller Ressourcen (Kohle, Öl) oder risikoreiche Endlagerungen „zusehends uns und besonders unsere Nachfahren immer mehr belasten und deshalb gilt es dagegenzusteuern“.
Bevor dieses Projekt am Wagensonnriegel realisiert werden könne, müssen entsprechende Gutachten eingeholt werden, wie ein Schallgutachten, Schattengutachten, Windgutachten und ein Naturschutzgutachten. Als Zielsetzung sei also angestrebt: Lokaler Beitrag für ein globales Problem.
Bernhard Pürzer von der Bürgerenergiegenossenschaft „Jurenergie“ zeigte an einem Beispiel aus dem Landkreis Neumarkt/ Opf. konkret auf, wie die Entwicklung einer Windkraftanlage Schritt für Schritt ablaufen könnte. Hierbei sprach er insbesondere die Problemfelder an, die sich ergeben werden, wie Genehmigung, Projektierung, Finanzierung, Bau und schließlich Unterhalt.
Einen informativen Beitrag leistete zu dem ganzen Komplex dann Andreas Scharf von der Fa. OSTWIND mit Sitz in Regensburg. Bei Planung und Bau setzt OSTWIND von Beginn an auf Information und Transparenz. Es werden die Fragen der Bürger/- innen beantwortet und alle Schritte werden eng mit den Beteiligten vor Ort abgestimmt: mit Behörden und Kommunalparlamenten und Grundstückseigentümern. Ein Markenzeichen von OSTWIND sei es, so führte er weiter aus, „dass wir bevorzugt Firmen aus der Region mit der Bauausführung beauftragen“. Schritt für Schritt dokumentierte er anschaulich mittels einer Powerpointdarstellung die Umsetzung eines solchen Projektes. Wagensonnriegel: Bürgermeister Roth spricht von offenem Prozess– Bevölkerung durch Informationen einbinden Im günstigsten Falle könne man das Vorhaben in drei Jahren verwirklichen. Strom aus Windkraftanlagen sei sehr billig, nämlich nur 7 ct/KW. Auch er appelliertezumSchluss an die Zielsetzung, CO2 zu vermeiden mit dem Hinweis: „Wir können so nicht weiter machen.“
Nachfolgend hatten die Bürger das Wort und Fragen verschiedenster Art wurden beantwortet. Bürgermeister Karl- Heinz Roth nahm den Ball gerne auf, der ihm als verantwortlicher Kommunalpolitiker zugespielt wurde. Er werde sich auf keine Festlegung vorab einlassen und die weiteren Schritte wolle er in Infoveranstaltungen gemeinsam mit den Bürgern gehen. Ihm sei bewusst, dass letztlich der Gemeinderat das letzte Wort habe, wenn das Landratsamt grünes Licht zu diesem Projekt erteile.
Es kristallisierte sich bei weiteren Fragen heraus, dass die Bayerischen Staatsforsten Projekte mit Bürgerbeteiligung, wie hier, bevorzugen, wenn sich positive Ansätze dazu ergeben.
Die Frage nach einer Lärmbelästigung wurde von den Verantwortlichen zu 100 Prozent verneint , da sich die Rotoren nur sehr langsam drehen würden. Als Zufahrt zum Windpark genüge eine 4,5 Meter breite Straße, die 12-Tonnen-Achslast aushalte. Die Fundamente würden bis zu einer Tiefe von vier Metern gebaut. Für die Erhaltung der Anlage werde die Betreibergesellschaft verantwortlich sein und schon beim Start werde eine Rückbaubürgschaft fällig. Die Anlagen würden in der Regel nach 20 Jahren genau überprüft. Die weiteren Befürchtungen der Anwesenden drehten sich unter anderem über die optische Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.
Der Meinungsaustausch verlief äußerst diszipliniert. Alle Argumente aus den konträren Positionen waren jeweils durchaus nachvollziehbar, aber immer ohne Aggression vorgetragen. Das sieht auch Bürgermeister Roth auf Anfrage des Grafenauer Anzeiger so: „Ich habe selten eine so sachliche Diskussion erlebt. Die Bürger waren kritisch, im positiven Sinne, keine fundamentalen Gegner. Und es ist absolut nachvollziehbar, dass die Wertschöpfung in der Region bleiben soll.“
Quelle: Passauer Neue Presse vom 12.08.2014
Autor: Franz Stockinger

Kooperation von Technologie Campus Freyung und Staatlicher Realschule Freyung
Seit einigen Jahren kommen die Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufen an der Realschule Freyung im Rahmen des Wahlfaches Biologie Übungen in den Genuss eines Bioniknachmittages, durchgeführt von Kirsten Wommer, Mitarbeiterin am Technologie Campus in Freyung und initiiert von Angelika Hemmerling. Dadurch entstand die Idee für eine Lehrerfortbildung, unterstützt durch den zweiten Konrektor Thomas Aigner.
Unter Bionik stellt sich inzwischen fast jeder den Lotuseffekt vor.Welchen Stellenwert Bionik in verschiedenen Wirtschaftsbereichen hat, überraschte die Lehrerkolleginnen und -kollegen von Grund-, Mittel- und Realschule doch sehr. „Inzwischen existiert ein Bionik Netzwerk in Deutschland und in Europa, an dem auch der Technologie Campus Freyungbeteiligt ist“, informierte Kirsten Wommer.
Bionik versucht Entwicklungen aus der Natur in technischen Anwendungen umzusetzen. Begonnen hat die bionische Anwendung mit der Erfindung des Salzstreuers (Vorlage war die Mohnkapsel) von Raoul Heinrich Francé mit dem ersten Patent dazu 1920 und dem Klettverschluss (Vorlage war die Klette und das Hundefell) von Georges de Mestral 1951.
Um den Lehrerinnen und Lehrern einen Einblick zu geben und einfache Schülerversuche zum Kennenlernen zu vermitteln, konnten sich alle an der Faltungsstruktur eines Insektenflügels versuchen. Ein vergleichbares technisches Faltungssystem wird bei Satelliten angewandt, die erst im Orbit ihre Sonnensegel zur Energiegewinnung entfalten.
Eine etwas schwierigereHerausforderung war der Nachbau einer Fischflosse (Fin-Ray). Diese Bauart wird in der Technik z.B. bei der Konstruktion von fingerartigen Greifern bei Robotern verwendet, die empfindliche Bauteile handhaben und selbst rohe Eier von Roboterarm zu Roboterarm weitergeben können. Auch beim Bau von Stuhllehnen und Autositzen, die sich optimal an die jeweilige Rückenform anpassen, ist diese Technik gefragt.
Der erste Teil der Bionikfortbildung zeigte wie wichtig es ist, die Natur mit anderen Augen zu betrachten und auszuprobieren. Dadurch entstehen Ideen für neue Entwicklungen und somit auch Berufschancen.
Im zweiten Teil konnten sich die Teilnehmer davon überzeugen, wie in einer experimentellen Unterrichtseinheit von Angelika Hemmerling und Carmen Mühlbauer der Lotuseffekt von Schülerinnen und Schüler erarbeitet, erlebt und auch verstanden wurde. Danach durften die Lehrerinnen und Lehrer wieder selbst aktiv werden und an den verschiedenen Stationen, die von Kirsten Wommer mitgebracht wurden, experimentieren.
Untersucht wurde die Festigkeit von Klettverschlüssen, Modelle wurden gebaut, um den Strömungswiderstand zu testen. Verschiedene Fragestellungen wurden „unter die Lupe“ genommen, z.B. wie man materialsparend haltbare Wände bauen kann, wie die Spannungsverteilung in Materialien genutzt werden kann und auch ein hydraulischer Muskel wurde auf Tauglichkeit geprüft.
Quelle: Passauer Neue Presse vom 29.07.2014


Bürgermeister und Planer betonen die Notwendigkeit, die Bevölkerung von Beginn an miteinzubinden
Der erste Schritt auf dem Weg zu einem Nahwärmekonzept für die Stadt Grafenau besteht für Bürgermeister Max Niedermeier in der umfassenden und kompetenten Information. Deswegen hatte er vor kurzem zusammen mit den Vertretern des Technologie Campus Freyung, Dipl.Ing. Josef Pauli und seinem Assistenten Simon Sandner sowie Manfred Schmalhofer von der Firma „Ecoplan“ alle Grafenauer zur Auftaktveranstaltung in den Bürgersaal eingeladen.
Die Bürgerbetreuung in Sachen Nahwärme wird sich in nächster Zukunft auch durch Besichtigungstermine der schon umgesetzten Nahwärmeversorgungsanlagen in den Nachbargemeinden Freyung und Waldkirchen – unter fachlicher Begleitung durch die Spezialisten des Technologie Campus Freyung und der Firma Ecoplan – und vielen Informationsveranstaltungen fortsetzen.
Doch zunächst gab Diplomingenieur Josef Pauli, der lange Jahre im Anlagenbau tätig war und somit „ein Mann der Praxis ist“, einen Überblick über das angedachte Gesamtkonzept für ein Nahwärmenetz in Grafenau. Als wichtige Ziele nannte er die individuell an Grafenau angepasste Auswahl möglicher Standorte und die Erörterung der jeweils genau für die Bedürfnisse passenden Anlagen zusammen mit den Anwohnern.
Informiert werde dabei ausführlich über Fragen wie Emissionen von Feinstaub und Lärm, sowie über mögliche Netz- und Anlagen- Betreibermodelle.
Zu den schon bestehenden Anlagen der Firma „Ecoplan“ in verschiedenen Gemeinden im Landkreis hatte Manfred Schmalhofer einiges Bildmaterial dabei, aber den besten Eindruck davon – und weitere Informationen zum Thema – gebe es am 12. Juni bei einer Bustour, die um 18 Uhr am Busbahnhof Grafenau startet und die die Erste von einigen Veranstaltungen zum Thema Nahwärme sein wird. Denn vielfach kämen erfahrungsgemäß Ängste und Bedenken nur dort zustande, wo nicht genügend Information gegeben werde.
Das Konzept, das noch in diesem Jahr fertig vorliegen soll, stützt sich bei der Ausarbeitung auf einen möglichst genauen Energiebedarf, der in Grafenau mit Hilfe bestehender Kataster und mit einem Fragebogen an alle Hausbesitzer ermittelt werden wird. Der Fragebogen, den der Technologie Campus Freyung erarbeitet habe, und der streng nach Datenschutzbestimmungen behandelt werden wird, liege im Herbst der Wasserabrechnung bei. Bürgermeister Niedermeier wünscht sich von „seinen Mitbürgern eine aktive Beteiligung an allen Informationsveranstaltungen und bei der Ausfüllung dieser wichtigen Fragebögen, umfür Grafenau das perfekte Nahwärmekonzept“ erarbeiten zu können.
Als überaus wichtig nannte Pauli auch das geeignete Betreiberkonzept der Nahwärmeversorgung. Die Anlagenbetreiber und die Netzbetreiber sollten dabei idealerweise nicht in einer Hand liegen, um Interessenkonflikte möglichst auszuschließen. Für das Netz wäre eine kommunale Gesellschaft der Stadt in der Mehrheit von 51 Prozent sinnvoll, aber auch die Bürger sollen zu 49 Prozent in Form von Genossenschaften eingebunden werden. Mögliche Modelle seien gerade in der Erarbeitungsphase. Lieferanten für die Energie könnten die Kommune, Gewerbe, aber auch private Einspeiser sein.
Verschiedene Energieträger wie Pellets oder Biogas waren ebenfalls ein wichtiger Punkt in Paulis Erläuterungen zum Thema. Vorhandene Anlagen und Nahwärmeversorgungen könnten hier Vorbild sein, aber wichtig sei die Erstellung des genau richtigen Konzeptes für jede Stadt. Großes Interesse gebe es erfahrungsgemäß auch immer bei der Frage der Emissionen. Die Nachbarn eines Nahwärmestandpunktes sollten genauestens über Feinstaubbelastungen oder Schallemissionen informiert sein.
Pauli verglich daher in seinem Vortrag die zu erwartenden Feinstaubbelastungen an einem fiktiven Standort in Grafenau mit den vorhandenen Gegebenheiten. Gegenüber herkömmlichen Kaminöfen würde der Kohlenmonoxid-Wert zum Beispiel erheblich sinken. Bedenken beim Thema Lärm versuchte Simon Sandner zu entkräften, der zu diesem Thema seine Bachelorarbeit verfasst hat. Der Geräuschpegel im Umfeld von Nahwärmeanlagen sei vergleichbar mit einem Pegel eines normalen Gespräches und verringere sich mit zunehmendem Abstand auf die Werte eines Blätterrauschens. Die Frage aus dem Publikum, ob es sich dabei um hoch- oder niedrigfrequente Töne handele, nahm Josef Pauli in seine weiteren Untersuchungen mit auf. Bei demnächst vorgenommenen Messungen will er das genau abklären lassen.
Bei der Verlegung der Leitungen für die Nahwärme sei eine gute Koordination mit der Stadt in der Zukunft das A und O. Die Vor- und Rücklaufrohre hätte einen sehr geringen Wärmeverlust und würden so höchst effektiv arbeiten.
Als Spezialist für die Technik steht Manfred Schmalhofer für Detailfragen auch bei der Informationsfahrt am 12. Juni Rede und Antwort. Wer immer aktuell über das geplante Nahwärmenetz informiert sein möchte, kann alle Einladungen und neuen Entwicklungen per E-Mail direkt erhalten. Näheres dazu erfährt man bei der Stadtverwaltung in Grafenau.
Bürgermeister Max Niedermeier betonte, dass es wünschenswert sei, dass möglichst alle eventuell auftretenden Bedenken gegenüber dem Nahwärmekonzept durch den Technologie Campus Freyung und die Firma Ecoplan im frühesten Vorfeld ausgeräumt würden. Dazu wäre eine große Beteiligung an den kommenden Informationsangeboten wünschenswert. An der spontanen Umfrage im Bürgersaal Pro/Contra Nahwärme war zu ersehen, dass bei der Auftaktveranstaltung zunächst nur interessierte Befürworter der Energiewende in Grafenau teilgenommen haben.
Aber gerade die imaginären Gegner dieses Konzeptes sollten sich künftig durch kompetente Aufklärung durch die Fachleute über Nutzen und Risiken neuer Wege in der Energiepolitik der Stadt Grafenau schlau machen, denn viele Vorurteile und Bedenken können erfahrungsgemäß schon in der frühesten Planungsphase ausgeräumt werden, damit das Nahwärmekonzept auch in Grafenau ein Erfolgsmodell zum Nutzen Aller werden kann, wie es bereits die Nachbarn Freyung und Waldkirchen vorgemacht hätten.
Quelle: PNP vom Dienstag, 10. Juni 2014
Autorin: Martina Höf-Keim

Die Energiewende ist aktueller denn je.
Dieses Fazit zogen Referenten und Besucher bei der Auftaktveranstaltung zum Energiekonzept in der Stadthalle. In erster Linie geht es darum, zu ermitteln, was in Sachen erneuerbarer Energien und Klimaschutz machbar ist und wie dies in der Kommune umgesetzt werden kann.
Pfarrkirchen ist im Bereich der erneuerbaren Energien schon vorangeschritten. Zu dieser Erkenntnis sind die Experten, die im Jahr 2013 von Stadtrat und Werkausschuss mit der Erstellung des Energienutzungskonzeptes beauftragt wurden, gekommen. Den Zuschlag für das Projekt erhielt damals die Firma Green City Energy gemeinsam mit dem Technologie Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf.
Umfangreiche Daten zu Energieverbräuchen in Pfarrkirchen wurden von den Verantwortlichen erhoben, außerdem die Potenziale erneuerbarer Energien für die Versorgung ermittelt. Die endgültigen Ergebnisse werden in so genannten "Energiewerkstätten", an denen sich auch möglichst viele Bürger beteiligen sollen, präsentiert. Die Arbeitskreise finden am 28. Juni und 26. Juli statt.
Quelle: Passauer Neue Presse
Foto: Wagle

Starke Nachfrage nach Energiespartipps im Ilzer Land
Im Rahmen der Aktionstage Bauen mit Holz & Energetische Sanierung sind die energierelevanten Themen sehr gut angenommen worden.
"Da kommt was in Bewegung im Ilzer Land in Sachen Energie", resümieren die beiden federführenden Max Köberl und Josef Gutsmiedl, bei einem Rückblick auf die Veranstaltungen am ersten Maiwochenende. Mit der Übergabe des Intergierten Energiekonzepts an die acht beteiligten Kommunen wurde der Startschuss für die Umsetzung der vielseitigen Maßnahmen gegeben. Die Kommunen haben hier mit diversen Maßnahmen in öffentlichen Liegenschaften ihre Hausaufgaben bereits begonnen und gehen mit gutem Beispiel voran. Nun sollen auch gezielt die Bevölkerung und die Wirtschaft auf den Zug zur Energiewende in der Region aufspringen und alle Zielgruppen ihren Beitrag zum Energie-3-Sprung (Energiesparen - Energieeffizienz fördern - erneuerbare regionale Energieträger nutzen) leisten.
Die interaktive Energieausstellung "Unser Haus spart Energie - gewusst wie", die über 10 Tage im Rathaus Grafenau stand, konnte knapp 500 Einzelpersonen und Schulgruppen zum engeriebewussten Umgang im Eigenheim informieren. Fachkundige Informationen verbunden mit einer regen Diskussion erhielten die Teilnehmer der CARMEN-Fachvorträge "Nachhaltigen Bauen und Sanieren". Abschließend zu den Aktionstagen nutzten viele Bürger aus der Region den Bau- und Energieberatertag, um sich kostenlos und vor allem neutral beraten zu lassen.
Die Resonanz an dem bunt gemischten Informationsangebot bekräftigt die Verantwortlichen Im Handlungsfeld Energie mit weiteren Aktionen zur Bewusstseinsbildung beizutragen.

Die Aktionstage Holz in Grafenau sind leider vorbei. Sie waren ein Erfolg!
Rund 450 Besucher haben schauholz besichtigt, alleine am gestrigen Sonntag waren es rund 200. Darüber hinaus kamen unsere Begleitveranstaltungen gut an. Am Samstag beim Architektentag von TANO waren ca. 40-50 Personen zu den Fachvorträgen und der Podiumsdiskussion anwesend.
Auch die Bürger interessierten sich am gestrigen Sonntag zahlreich für die Beratung der Fachleute – Energieberater des Landkreises und Holzbauunternehmer des Netzwerkes Forst & Holz – im Rathaus.

Acht Kommunen der ILE Ilzer Land erhielten Integriertes Energiekonzept überreicht - Jetzt geht die Arbeit richtig los
Damit man nicht auf den „Holzweg“ gerät, braucht man Wegweiser. Oder genau dahin? Was hat die Region an Bedarf und Möglichkeiten energetischer Art? Könnte sie sich selbst versorgen oder gar noch Energieexporteur werden? Welche Rolle spielen dabei Holz, Wasser, Wind und Sonne? Und wie abhängig ist man von Öl oder Gas, wenn man dafür sorgt, dass man sie nicht mehr in dem Maß benötigt wie derzeit? Es ist ein großer Fragenkatalog, der in das Energiekonzept des Ilzer Landes einfloss. Aber dabei soll es nicht bleiben. Es geht um Antworten für die Zukunft, die gestern im Rahmen der Aktionstage Holz in Grafenau „übergeben“ wurden.
Seit anderthalb Jahren arbeitet das Handlungsfeld Energie in der ILE Ilzer Land daran, zusammen mit Partnern wie dem Amt für Ländliche Entwicklung als Förderer oder dem Technologiecampus in Freyung, Daten zu erheben und Lösungsstrategieen zu entwickeln. Manches befindet sich schon in der Umsetzungsphase, etwa bei Beleuchtungen oder Heizungen von kommunalen Liegenschaften. Manches wird auf mittlere oder lange Frist anzupacken sein. Was aber nicht sein soll: dass das Konzept in einer Schublade verschwindet.
Dr. Christian Thur-maier vom Amt für Ländliche Entwicklung meinte dazu in seinem Impulsreferat, dass dafür eine 70-prozentige Förderung zu schade wären. Für das Amt seien Innenentwicklung und Energiefragen zwei ganz zentrale Themen. Man dürfe einfach nicht in der Theorie stecken bleiben, sondern müsse das Erarbeitete auch nutzen. Man solle sich nicht verwirren lassen von großen politischen Themen. Wichtig sei, dass ein Umdenkprozess stattfinde, bei denen kommunale Liegenschaften gerne auch beispielgebend sein dürfen, damit man sieht: Jeder kann auf Dauer viel sparen. Im „Energie-Dreisprung“ aus Sparen, Nutzen und Erzeugen müsse man heute noch sehen, dass pro Kopf etwa 1200 Euro jährlich an Energieimporten stattfinden. Bei einer derzeit auch wieder instabileren Weltlage heiße das zunehmend, dass Warten Probleme auf zukünftige Generationen abwälzen hieße.
Wo konkret Chancen zu sehen sind, das erläuterte Josef Pauli als Energiespezialist des TC Freyung anhand des vorgelegten Zahlenmaterials. Er meinte, dass der Übergabetermin auch keine Abschlussveranstaltung sein dürfe. Jetzt gehe es erst richtig los. Wo wird der meiste Strom verbraucht? Woher kommt unsere Wärme? Könnten wir da sogar autark werden? Bei Strom sieht es sogar gut aus, dass die Region Exporteur etwa für Ballungszentren werden kann. Bei Wärme? Es wäre zu schaffen, auch wenn seiner Meinung nach etwa bei Holz weiter lieber ein gut gedämmtes Massivhaus daraus werden sollte, statt darin damit zu heizen. Aber es geht ja nicht nur um „jetzt und brauchen“, sondern auch um effektivere Nutzung, um Sanierungschancen, um ein Einsparpotenzial, das im Ilzer Land bei 6,7 Millionen jährlicher Einsparung an Wärmeerzeugung errechnet wird. Dafür sei zwar ein Investitionsaufwand von 140 Millionen nötig. Aber darin steckten dann auch Wirtschaftsförderung vor Ort und Arbeitsplätze in der Region. Das vorgelegte Konzept sei ein Kataster der Möglichkeiten. Vor allem dann, wenn, wie er fest annimmt, es künftig neue Währungen gibt. Wie das CO2. Welchen Ausstoß darf man sich noch leisten? Finanziell und ökologisch?
Professor Wolfgang Dorner vom TC Freyung fügte dazu an. Auch wenn man meinen könnte – angesichts der aktuellen Diskussion in Berlin und München – die Energiewende sei tot, könne man allenfalls davon reden, dass ein Boom vielleicht vorbei sei, die Vernunft statt der Triebe aber dadurch erst Raum gewinnen. Wasübrig bleibe: Technologien für die Zukunft. Genau dafür seien die Umsetzungen jetzt umso wichtiger. In längeren Zeiträumen gedacht, sei das fossile Zeitalter eben vorbei. Man komme an die Grenzen der Ausbeutung.
Wenn es um den „Profit“ eines Wendebooms nicht mehr gehen kann, dann gehe es eben darum, wie man dauerhaft davon profitieren kann, dass der Grundgedanke in der Fläche angekommen ist. Da gebe es eine Lücke zusammen mit den Menschen zu füllen. In manchen Kommunen seien die Ergebnisse schon genutzt worden,umProjekte anzustoßen. Damit etwa die Steckerleiste selbstverständlich wird, mit der sinnlose Stand-by- Verbraucher effektiv und wirksam ausgeschaltet werden, so brauche es vor Ort auch Steckerleistenpersönlichkeiten, an die angeknüpft werden kann und die Power verteilen.
Dazu regte Christian Thurmaier auch an, Energiebeauftragte zu bestellen und einen Klimaschutzmanager zu installieren. Ergebnisse sollten in Bauleitplanungen einfließen und Informationspolitik sollte Überzeu- Warten wälzt Probleme ab AchtKommunender ILE Ilzer Land erhielten Integriertes Energiekonzept überreicht - Jetzt geht die Arbeit richtig los gungsarbeit leisten. Josef Pauli empfahl ebenfalls, dass ein jährliches kommunales Budget dafür in jeder Gemeinde Pflicht sein sollte. Und auch Wolfgang Dorner zeigte sich sicher, dass Theorie und Praxis schon gut zusammenspielen könnten, wenn es jetzt per Konzept an die Kommunen hinaus ginge.
Wie Idee und Realität auf einen Nenner kommen können, das zeigt übrigens auch die Ausstellung, die parallel zu den Aktionstagen Holz im 1. Stock desm Grafenauer Rathauses gezeigt wird. „Unser Haus spart Energie - Gewusst wie“ erklärt anschaulich, wie etwa Hausbesitzer mit Dämmung, moderner Haustechnik oder Biomasse den Kopf nicht mehr nur bei der kommenden Energieabrechnung haben müssen. Sechs Themenhäuser bieten Einblicke von „Heizkostenrechner“ bis Alternative. Auch darüber soll der Bildungsauftrag der „Öffentlichen Hand“ weiter verfolgt werden. Denn die größten Potenziale liegen laut Energiekonzept in gewerblich genutztem Strom und Wärme in Haushalten. Und da gehe auch viel, statt nur darüber zu reden.
Quelle: Passauer Neue Presse vom 3. Mai 2014
Autor/Foto: Hermann Haydn

Bisher setzen im Landkreis kaum Autofahrer auf E-Autos - Wissenschaftler: „E-Auto reicht fur 95 Prozent der Fahrten"
Die Bilanz für die Region ist mager: Lediglich acht von insgesamt 78.092 im Landkreis zugelassenen Fahrzeugen haben einen reinen Elektroantrieb. Gerade bei Privatpersonen scheint E-Mobilitat noch nicht attraktiv zu sein. Nur drei der acht Fahrzeuge sind auf Privatpersonen zugelassen. Die übrigen fünf befinden sich in Firmenhand.
Dem E-Auto aber soll die Zukunft gehören. Doch wie steht es um Infrastruktur, Nutzerfreundlichkeit und Leistungsfahigkeit der E-Autos? Die PNP hat sich bei einem privaten Nutzer, Kommunen, der Wissenschaft und bei E-Wald umgehört.
Der Privatnutzer
Nur ein leichtes Surren ist zu hören, wenn Hans-Peter Neumaier aufs Gaspedal drückt. Anfangs habe er die typischen Motorengeräusche eines Verbrenners schon vermisst, „aber man gewöhnt sich schnell an die Ruhe beim Autofahren". Seit Dezember fährt Neumair mit dem E-Auto seines Arbeitgebers nach Feierabend auch privat durch den Landkreis. Tagsüber nutzen die Mitarbeiter der Sparkasse Freyung den Fünftürer für Dienstfahrten. „Ich wollte em E-Auto schon lange mal ausprobieren", sagt Neumair. Da kam das E-Wald Mitarbeitersharing-Modell seines Arbeitgebers gerade recht.
Die Abstimmung während des Arbeitstages klappt reibungslos. Neumair stellt den Wagen ab 8 Uhr morgens für Dienstfahrten zur Verfügung, ab 16 Uhr kann der Bankangestellte mit seinem Auto wieder nach Hause fahren. Sein Fazit nach rund drei Monaten ist positiv. Rund 90 Prozent der Fahrten kann Neumair mit dem E-Auto zurücklegen. „Wir nutzen den Wagen privat als Zweitwagen. Die Reichweite des E-Autos von etwa 100 Kilometern reicht völlig aus", so Neumair. Neben Fahrten zum Einkaufen, nutzt der Neuschänauer den Wagen für die rund 18 Kilometer lange Strecke zu sei-nem Arbeitsplatz. Ein eigenes E-Auto will sich Hans-Peter Neumair allerdings nicht zulegen. „Der deutlich höhere Anschaffungspreis gegenüber einem Diesel oder Benziner und die geringe Reichweite, die Fahrten in den Urlaub verhindert, machen einen Kauf nicht wirklich attraktiv."
Der E-Dienstwagen
Emissionsfrei im Dienst unterwegs ist seit Jahresanfang die Gemeinde Hohenau. Im Januar wurde zudem eine öffentliche Ladesäule in der Gemeinde in Betrieb genommen. „Wir sind sehr zufrieden, die 120 Kilometer Reichweite genügen für unsere Zwecke", so Gemeindegeschäftsleiter Andreas Seidl. Gemeindemitarbeiter und Bürgermeister Eduard Schmid nutzen das Fahrzeug.
Bereits seit August 2013 fahren die Mitarbeiter der Gemeinde Perlesreut mit dem gemieteten Dienstwagen von E-Wald schadstofffrei. „Wir sind vom Konzept der E-Mobilität überzeugt und wollen das unseren Bürgern aktiv vorleben", so Bürgermeister Manfred Eibl.
Für die Gemeinde ist das Öklogisch wie ökonomisch ein guter Deal. In der Leasingrate von 300 Euro seien alle Versicherungen, Steuern sowie größere Reparaturen bereits enthalten, heißt es von der Gemeinde. Da der Strom aus der neuen E-Wald-Ladesäule kommt, ist er gratis. Doch bis die Ladesäule endlich in Betrieb genommen werden konnte, habe es mehrere Monate gedauert, so Eibl. „Wir waren zum Teil sehr erbost über die verzögernden Lieferschwierigkeiten."
Die Abstimmung unter den Mitarbeitern läufe hingegen reibungslos. Damit das System künftig auch reibungslos läuft, soll es einen für alle Mitarbeiter einsehbaren öffentlichen „Nutzer-Kalender" geben.
Einziger Kritikpunkt der beiden Gemeinden ist ein fehlendes flächendeckendes Netz mit Schnellladesäulen. Nur dann könnten die E-Autos mit der geringen Reichweite effizient eingesetzt werden, heißt es aus Hohenau und Perlesreut.
Bislang nutzen ausschließlich Mitarbeiter der Verwaltung, des Bauhofs und der Bürgermeister das E-Auto für Dienstfahrten. Damit das E-Auto außerhalb der Dienstzeiten und am Wochenende ebenfalls genutzt wird, möchte die Gemeinde Perlesreut ab dem Frühjahr das Fahrzeug als Bürger-Kfz anbieten.
Das Carsharing
Geht es nach der E-Wald GmbH, sollen schon bald auch zahlreiche Bürger und Gäste in Freyung das mit Strom betriebene Fahrzeug nutzen. Seit gestern steht es bereit. Deshalb wurde im Parkhaus an der Bahnhofstraße auch eine extra Ladestation installiert. „Wir sehen ein großes Nutzerpotenzial für Freyungs Bürger sowie im touristischen Bereich", so Anton Achatz, bei E-Wald für das operative Geschäft verantwortlich. Geht es nach E-Wald, soll zunächst mit einem Auto gestartet werden. „Wenn der Bedarf groß genug ist, können wir die Flotte aber jederzeit erweitert."
Theoretisch könnten die Stromtankstellen im Parkhaus an der Bahnhofstraße auch schon seit Anfang März genutzt werden. Die Säulen wurden in der ersten Märzwoche in Betrieb genommen. Doch ein gelbes Absperrband verhinderte über Wochen die Zufahrt zu den Ladesäulen im Parkhaus. Da die für E-Autos reservierten Parkplätze noch nicht ausgeschildert waren, habe man das Flatterband angebracht um „Falschparken" zu verhindern, heißt es von E-Wald - dafür war die Stadt Freyung verantwortlich.
Doch auch die Stadt Freyung klagt über Verzögerungen. „Die Säulen stehen seit Dezember, geplant war die Inbetriebnahme Ende Februar, jetzt wurde es Ende März, bis die Anlage eröffnet werden konnte", so Hubert Wachter von der Stadt Freyung. Gestern aber war es dann end-lich soweit.
Die Wissenschaftler
Dass dem E-Auto die Zukunft gehört, davon ist Wolfgang Dorner, Professor für Informatik räumlicher Systeme an der Technischen Hochschule Deggendorf, überzeugt. Seit September 2013 widmet sich der Wissenschaftler am Technologie Campus Freyung mit semen Mitarbeitern dem Thema Energieversorgung. „Ein E-Auto produziert an sich keinerlei Emissionen, doch um es zu 100 Prozent schadstofffrei zu bekommen, muss auch der Strom CO2 - neutral erzeugt werden", sagt Dorner. Das Forschungsprojekt geht der Frage nach, wie für die Versorgung der E-Wald-Flotte regenerative Energie optimal produziert und genutzt werden kann.
Der Mensch im Mittelpunkt
Um Verbrauch und Fahrverhalten zu testen, benutzen die Mitarbeiter des TC Freiyung ein strombetriebenes Fahrzeug der E-Wald Flotte für Dienstfahrten. Die Mitarbeiter decken mit dem Kleinwagen, dessen Reichweite je nach Jahreszeit zwischen 70 und 100 Kilometer beträgt, Fahrten nach Deggendorf, Passau und innerhalb des Landkreises ab. In der Regel reicht der Akku für alle Fahrdistanzen aus. „Natürlich haben wir den Vorteil, dass zwischen Ankunft und Abfahrt wegen Besprechungen oder Workshops oft mehrere Stunden liegen, in denen das Auto aufgeladen werden kann", so Dorner.
Bei den Dienstfahrten wird unterwegs das E-Wald-Ladestationennetz gut genutzt. „Ein unbedarftes einfach drauf los Fahren ist natürlich schwierig, doch wir wissen, wo unsere Ladesäulen stehen, und planen unsere Fahrten gründlich", beschreibt Dorner das Fahrverhalten. Die Diskussion um die noch geringe Reichweite von E-Autos, kann Dorner schwer nachvollziehen. „Eine Studie des Frauenhofer-Institutes belegt, rund 95 Prozent der täglich absolvierten Fahrten bewegen sich zwischen 5 und 50 Kilometern." Peripherie und E-Auto - für den Experten auch aus eigener Erfahrung kein Widerspruch.
Dem Kostenargument für die teuere Anschaffung eines Elektroautos hat Dorner auch etwas entgegenzusetzen. „Die Stromkosten für ein mal Vollladen, sind deutlich günstiger als eine Tankladung." Und wer zum Stromerzeugen die eigene Photovoltaikanlage nutze, helfe der Umwelt und dem Geldbeutel.
Quelle: PNP vom 28.03.2014
Autor: Von Verena Wannisch

MdL Max Gibis spricht mit Professor Wolfgang Dorner über die anstehende Weichenstellung
Landtagsabgeordneter Max Gibis nahm das Auslaufen der fünfjährigen Anschubfinanzierung des Technologie-Campus in Freyung zum Anlass für ein Gespräch mit den beiden Leitern des Campus Professor Dr. Wolfgang Dorner und Karl Kreuß.
Neben dem Campus in Teisnach war der Technologie-Campus in Freyung als Einrichtung der Technischen Hochschule Deggendorf einer der Pilot-Campi im Bayerischen Wald. Dementsprechend ist der Campus in Freyung nun auch einer der Ersten, dessen Anschubfinanzierung durch den Freistaat Bayern ausläuft und bei dem nun die Weichen für die Zeit danach gestellt werden miissen.
Zunächst einmal informierten Professor Dorner und Karl Kreuß sowie Vizeprasident Prof. Dr. Andreas Grzemba den Abgeordneten über den aktuellen Ist-Stand am Campus. So hat sich die Hochschuleinrichtung in Freyung weit über den anfänglichen Erwartungen entwickelt und aus den nach fünf Jahren vorgesehen 12 bis 15 Mitarbeitern sind mittlerweile knapp 40 Mitarbeiter geworden. Außerdem requirierte der Campus in Freyung bisher weit mehr Projektaufträge von Unternehmen als ursprünglich erwartet wurde, so sind die Auftragsbücher bis Mitte des Jahres 2015 gefüllt.
Anders als bei vollständig von Unternehmen finanzierten Projekten muss der Technologie Campus bei öffentlich geförderten Projekten umfangreiche Kosten selbst tragen. Laufende Kosten wie Raummiete, Internetanschluss und Arbeitsplätze von Mitarbeitern werden im Gegensatz zu reinen Personal- und Materialkosten durch viele Förderprogramme nicht abgedeckt. An Universitäten und den Forschungseinrichtungen in den Ballungsräumen gibt es hierzu eine staatliche Grundfinanzierung, die aber dem Campus grundsatzlich fehlt.
Diese nicht durch Förderprojekte abgedeckten Kosten würden bisher durch die Anschubfinanzierung abgedeckt. Die Umsetzung von Forschungsprojekten mit Unternehmen als eines der wichtigsten Ziele des Campus erfordert somit die Grundfinanzierung, da sonst die Firmen die Möglichkeit verlieren, an wichtigen Förderprogrammen für Forschung- und Entwicklung mit dem Campus zusammen teilnehmen zu können.
Zu diesem Zweck hatte Max Gibis das Gespräch mit den Verantwortlichen des Technologie Campus gesucht. „Wenn es eine Regelung von staatlicher Seite für eine Grundfinanzierung geben wird, so muss diese Regelung für alle Einrichtungen dieser Art gelten", so Gibis, „denkbar ist allerdings eine individuelle Übergangslösung für den Campus in Freyung, bis ein Finanzierungskonzept für alle Technologie-Standorte gefunden wurde".
Professor Dorner konnte Gibis bereits ein eigens erarbeitetes Konzept zur Grundfinanzierung aller Technologie-Campi in ganz Bayern präsentieren, in dem die Campus-Standorte durch eine neuartige Struktur als Knotenpunkte für Angewandte Forschung und Entwicklung, Innovationsmanagement bzw. Technologieförderungen zu wichtigen Impulsgebern für neue Firmenansiedlungen, neue Arbeitsplätze und mehr Wachsturn werden. Das spannende Konzept sieht eine europaweit einmalige Struktur vor, die Synergieeffekte und Markenvorteile bietet.
MdL Max Gibis zeigte sich von dem Konzept begeistert. „Ich bin sicher, dass es irgendeine Regelung zur Grundfinanzierung der Technologie-Campi von staatlicher Seite geben wird, wieso sollte man die Campi also nicht gleich in ein tragfähiges Konzept mit vielen positiven Impulsen für den ländlichen Raum einbetten", so der Abgeordnete. Gibis versprach, zeitnah in München das Gespräch mit dem bayerischen Finanz- und Heimatminister Markus Söder zu suchen, um ihm das Konzept vorzustellen.
Quelle: Passauer Neue Presse vom 25.03.2014

Einladung zur Energiewerkstatt am 26. März 19:00 Uhr
Um das Energiekonzept Ebermannstadt erfolgreich umzusetzen, sind uns Ihre Ideen und Anregungen wichtig, deshalb laden wir Sie ganz herzlich zu unserer nächsten Energiewerkstätte am 26. März um 19:00 Uhr in die Grund - und Mittelschule Ebermannstadt ein.
Überdies bitten wir Sie, an unserer Energie-Umfrage teilzunehmen und den Fragebogen anschließend an Herrn Diepold (florian.diepold@th-deg.de) weiterzuleiten.

Fünf Jahre Technologie Campus Freyung
Seit der Technologie Campus (TC) in Freyung ansässig ist, ist der Statusbericht von Professor Dr. Wolfgang Dorner Tradition im Stadtrat. In der jüngsten Sitzung stellte er dabei erfreut fest, dass 2014 zum fünfjährigen Bestehen der Deggendorfer TH-Außenstelle in Freyung alle Erwartungen mindestens erfüllt, "wenn nicht übertroffen" worden sind.
Das Ziel zehn Mitarbeiter und fünf Studenten sei deutlich übertroffen worden. Derzeit sind laut Dorner (ohne Studenten) zirka 40 Personen − vom Professor bis zum technischen Mitarbeiter − beschäftigt.
2013 habe sich einiges getan: Zwar gab es Dorner zufolge einen Rückschritt, weil Projektmittel abgezogen wurden; durch Mittelneuzuflüsse hat es aber keine Einschränkungen beim Personal gegeben. Durch gute Projektarbeit konnten außerdem neue kleinere und größere Projekte akquiriert werden. Nachdem Prof. Dr.-Ing. Andreas Grzemba im vergangenen Jahr den TC verlassen hat, mussten die internen Strukturen neu organisiert werden. Mit einem neuen "Kanzler-Präsidenten-Team" konnte die Veränderungen kompensiert werden. Seit November ist nun ein zweiter Professor am TC, der Geoinformatiker Dr. Roland Zink. Diese Stelle wird je zur Hälfte vom Campus (aus Projektmitteln) und aus dem Haushalt der Hochschule Deggendorf finanziert.
Quelle: PNP vom 5.3.2014
Foto: Jahns

Technologie Campus Freyung entwickelt Hardware und Kommunikationsschnittstelle für Ladestationen
Die rund 110 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in der Region sind erst der Anfang für ein breites Netz der Elektromobilität. Jede dieser Ladestationen ist derzeit noch mit unterschiedlicher Technik ausgestattet. Auch die grafischen Benutzeroberflächen weichen sehr voneinander ab.Das sollte sich jedoch bald ändern.
Mit dem Projekt „Framework für Ladestationen“ im Rahmen des „Netzwerks für intelligente Ladetechnik“ (iLEM) entwickelt der Technologie Campus Freyung zusammen mit mehreren ostbayerischen Firmen und der Hochschule Regensburg ein Framework für die Software von Ladestationen.
Von diesem Framework profitieren sowohl die Nutzer, die Ladesäulenhersteller als auch der Betreiber. Für den Nutzer wird eine einheitliche grafische Benutzeroberfläche geschaffen, die zum einen eine Darstellung auf mobilen Geräten ermöglicht und zum anderen Informationen zum Ladeverlauf gibt. Wenn Ladesäulenhersteller das neu entwickelte Framework nutzen, kann dadurch die technische Entwicklung von Ladesäulen erheblich vereinfacht und beschleunigt werden. Durch die geplante Integration eines Service- und Reparaturmanagements profitiert der Ladesäulenbetreiber, da er beispielsweise Fehlermeldungen bekommt und umgehend Servicetechniker informieren kann.
Der Technologie Campus Freyung mit der Arbeitsgruppe Embedded Systems/Automotive Electronics erweitert daneben auch die Hardware und die Kommunikationsschnittstellen der Ladesäulen für eine Smart Grid-Fähigkeit. Smart Grids sind intelligente Stromnetze, die z.B. den Ladezeitpunkt in Abhängigkeit vom aktuellen Strombedarf im Verteilnetz bestmöglich wählen. Der Ladevorgang kann somit an den aktuellen Strombedarf im Verteilnetz des Energieversorgers angepasst werden, um beispielsweise Lastspitzen zu verringern. Der Kommunikationsbedarf zwischen Fahrzeug, Ladesäule und einem zentralen System wird dadurch erhöht und intelligent kontrolliert. Das im Projekt entwickelte System soll in Zukunft über eine standardisierte Schnittstelle an handeslübliche Ladeboxen angeschlossen werden können, sodass die entwickelten Vorteile eine breite Anwendung finden können.


Energiemanager des TC Freyung stellen Themen vor.
Die Energiemanager des Technologie Campus Freyung, Josef Pauli und Kirsten Wommer, haben für die Grundschüler im Landkreis ein Energie-Konzept erarbeitet. Damit erklären sie ihnen kindgemäß und mit Hilfe von Messgeräten die Themenkomplexe Energie, Raumklima, Wärme und Strom. Jetzt besuchten sie die 3. und 4. Klasse an der Grundschule Innernzell-Schöfweg.
Für die Schulkinder waren die Informationen über das richtige Raumklima im Klassenzimmer am Interessantesten, weil es bei diesem Thema viel zu messen gab. Damit die Kinder nicht vorzeitig ermüden und ihreKonzentrationsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird, dürfen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und derCO2-Gehalt bestimmte Werte nicht überschreiten.
Die Zahlenformel lautet 22-50 - 1500. Konkret: Die Temperatur im Klassenzimmer soll 22 Grad Celsius nicht überschreiten, die Luftfeuchtigkeit soll höchstens 50 Prozent betragen und die Obergrenze des CO2-Gehalts beträgt 1500 ppm. Gerade in geschlossenen Räumen, in denen sich viele Personen aufhalten, steigt der Kohlendioxid- Gehalt sehr rasch.
Der CO2-Messer zeigte an, dass öfters der Grenzwert überschritten wurde. Nach kurzem Lüften, genannt „Schocklüften“, hatte sich der Kohlendioxid-Gehalt wieder rasch normalisiert.
Mit Hygrometern durften die Schüler an verschiedenen Stellen die Luftfeuchtigkeit im Klassenzimmer messen. Sehr motivierend war die Temperaturmessung mit einer „Infrarot-Temperatur-Pistole“. Schulleiter und Fachberater für Umweltbildung, Siegfried Herrmann, lobte das gelungene Projekt, das den Kindern viele Möglichkeiten zu selbsttätigem und anschaulichem Lernen bot.
Quelle: PNP vom 8. Februar 2014

Am 27. März 2014 ist es soweit!
Jetzt anmelden und bei spannenden Kursen am Technologie Campus Freyung mitmachen!
Erhaltet einen Einblick in die Aufgaben und Arbeitsweisen der verschiedenen Arbeitsgruppen aus der Forschung: Informatik, Energie, Mobile Systeme und Bionik.
Im Bereich der Angewandten Informatik werdet ihr in die Grundkenntnisse des Programmierens eingewiesen. Mit Hilfe von einfachen Übungen werdet ihr lernen, wie man einen Roboter programmieren oder ein Haus am PC entstehen lassen kann.
In der Arbeitsgruppe Angewandte Energieforschung ist selber messen angesagt! Alltägliche Geräte wie Computer oder Handyladegerät werden näher untersucht, die Heiztechnik des Campus begutachtet und ganz nebenbei werdet ihr zu „Energieberaterinnen“ ausgebildet.
Die Mitarbeiterin aus dem Bereich Mobile Systeme & Software Engineering wird euch einen Einblick in ihren Arbeitsalltag geben, aber natürlich dürft ihr auch hier selber ausprobieren. Mit Hilfe von Computerprogrammen werden digitale Fotos bearbeitet und ausprobiert, wie mit einem einzelnen Klick ganz leicht Bilder verändern kann.
Die Arbeitsgruppe Bionik zeigt anhand verschiedener Experimente, die ihr selbstverständlich selber durchführt, was sich Wissenschaftler schon alles von der Natur für die Technik abgeschaut haben. Ihr erfahrt, warum manche Pflanzen nie schmutzig werden oder was ein Fisch mit einem Auto zu tun hat.
Teilnehmen können Mädchen ab der 8. Klasse.
Eine Anmeldung ist ab sofort über den folgenden Link möglich
http://www.girls-day.de/aktool/ez/eventvcard.aspx?id=52001
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!

Gemeinde und Bürger erstellen mit dem Technologie Campus Freyung ein Energiekonzept
„Wie soll die Gemeinde energetisch in Zukunft aussehen?“ Das ist die große Frage, sagte Professor Dr. Wolfgang Dorner von der Technischen Hochschule Deggendorf. Beantworten könnten sie nur die Bürger. Die Auftaktveranstaltung zur Erstellung eines Energienutzungskonzeptes für Aufhausen besuchten am Donnerstagabend in der Stiftsgaststätte 30 Zuhörer.
Fast drei Stunden lang folgten sie aufmerksam und interessiert den Ausführungen der Referenten, vor allem des Diplom-Ingenieurs Josef Pauli vom Technologie Campus Freyung, der ganz konkrete Beispiele für Energie- und somit Kostenersparnis durch bewusstes Handeln gab. Die Zuhörer sollen nun in der Bevölkerung Werbung zur Mitarbeit in den nachfolgenden Energiewerkstätten machen.
Ein paar Zuhörer mehr hätte sich Bürgermeister Johann Jurgovsky wohl doch gewünscht. Er nahm die Begrüßung vor und hieß die Referenten Professor Dr. Wolfgang Dorner von der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), Raphaela Pagany, Josef Pauli und Florian Diepold vom Technologie Campus (TC) Freyung sowie Elisabeth Sternemann vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) willkommen. „Wie versorgen wir uns in Zukunft mit bezahlbarer Energie?“, fragte Jurgovsky. Gemeinsam mit den Bürgern wolle sich die Gemeinde darüber Gedanken machen.
Begleitet und betreut werde der Prozess, an dessen Ende in etwa einem dreiviertel Jahr ein Energiekonzept mit konkreten Maßnahmen vorliegen soll, vom Technologiecampus Freyung, der zur THD gehört. Die Wissenschaftler haben unter anderem für den Landkreis Regen ein Energiekonzept erstellt. Ein wichtiges Thema sei auch das Einsparen von Energie. Hier sah Jurgovsky auch für die kommunalen und kirchlichen Gebäude viele Ansatzpunkte.
Im sogenannten „Dreisprung“ – Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und erneuerbare Energien – wolle man zur Umsetzung der Energiewende beitragen, sagte Professor Dorner. Am Beispiel der Ölpreisentwicklung zeigte er die Brisanz dieses Themas für die Zukunft auf. Die Staatsregierung habe mit dem „Dreisprung“-Verfahren eine politische Vorgabe gemacht, deren Umsetzung vor Ort jedoch in der Entscheidung der Kommunen und ihrer Bürger liege. Die Vorarbeiten und das Wissen dazu liefere der TC Freyung mit einem Team von 40 Mitarbeitern.
Jeder kann mitmachen
Die Technologien seien vorhanden. Es sei aber auch der Wille notwendig, diese einzusetzen, betonte Dorner. Die Bürger sollten sich überlegen, was sie zulassen wollen, was sinnvoll für die Gemeinde ist. „Das Energiekonzept dient dazu, Leitlinien und Visionen zu entwickeln. Hier ist die Meinung der Bürger gefragt“, machte Professor Dorner deutlich. Das Verfahren zur Entwicklung dieses Energiekonzeptes zeigte Florian Diepold auf. „Als Ergebnis sollen konkrete Maßnahmen stehen, die sinnvoll umsetzbar sind und eine realistische Strategie für die Zukunft beinhalten.“ Derzeit laufe die Datensammlung zur Analyse des Ist-Zustandes. Diese Analyse werde in sechs bis acht Wochen bei der ersten Energiewerkstatt vorgestellt. Eine große Bedeutung komme dabei der Bürgerbeteiligung zu. Denn bei der Energiewerkstatt sollen die Bürger in Themengruppen die Visionen für die Gemeinde entwickeln. Beraten und betreut werden sie dabei von verschiedenen Experten. Diepold appellierte an die Zuhörer, im Bekanntenkreis Werbung für diese Bürgerbeteiligung zu machen. „Jeder kann mitmachen“, sagte Diepold.
Aufhausen wurde neben Brennberg als einzige Gemeinde im Landkreis in ein Programm aufgenommen, das die Erstellung eines Energiekonzeptes zu 75 Prozent fördere, sagte Elisabeth Sternemann vom ALE Oberpfalz. Das Amt begleite den Prozess. Um zu verhindern, dass das Energiekonzept „ein Papier für die Schublade“ wird, gibt es für die Umsetzung – auch für Private – verschiedene Fördermöglichkeiten.
Beispiele zum Energiesparen
Zum Abschluss der Veranstaltung zeigte Josef Pauli mit sehr konkreten Beispielen auf, wie man durch bewusstes Handeln Energie und damit bares Geld sparen könne. Durch eine bedarfsgerechte und individuelle Anpassung seien bei der Heizung Einsparungen ohne große Investitionen möglich. Je nach technischer Begabung könne man diese selbst vornehmen oder durch Fachfirmen vornehmen lassen. Aber allein schon durch das Herablassen der Rollos über Nacht werde die Wärme länger im Raum gehalten. Weiter ging er auf Einsparmöglichkeiten beim Stromverbrauch ein. Bei Haushalts- und Unterhaltungsgeräten solle man zum Beispiel auf den Stand-by-Modus verzichten. Man solle darauf achten, dass Geräte wie Kühlschrank oder Gefriertruhe richtig aufgestellt werden. Auch LED-Beleuchtung bringe mitunter auf längere Sicht eine Kosteneinsparung, erläuterte Pauli. Mit vielen kleinen Maßnahmen könne man so insgesamt bis zu 500 Euro jährlich sparen.
Quelle: Allgemeine Laber-Zeitung vom 01.02.2014


Technologie Campus Freyung stellt Integriertes Energiekonzept vor.
Rund 50 Stadt-, Markt- und Gemeinderäte aus Grafenau, Schönberg, Saldenburg und Thurmansbang waren mit ihren Bürgermeistern zu einer gemeinsamen Ratssitzung in die Festhalle Thurmansbang gekommen, wo das Integrierte Energiekonzept (IEK) für die Kommunen des Ilzer Landes von Josef Pauli, Technischer Leiter der Arbeitsgruppe Angewandte Energieforschung des Technologie Campus Freyung vorgestellt wurde.
Pauli betonte, dass auf Grund des von seinem Team erarbeiteten Konzeptes das Ilzer Land durchaus in der Lage sei, den in der Region benötigten Strom und die Wärme größtenteils selbst zu erzeugen und so rund 25 Millionen Euro jährlich an Wertschöpfung für die Region zu generieren.
Bürgermeister Max Köberl (Ringelai), der zusammen mit Bürgermeister Josef Gutsmiedl (Röhrnbach) bei den Ilzer Land- Gemeinde das Handlungsfeld „Energie“ betreut, erinnerte an die einjährige Vorbereitungszeit des IEK, dessen Ziel es sei, mit möglichst vielen realistischen Maßnahmen, die zeitnah umzusetzen seien, der Energiewende auch in den Kommunen den Weg zu bereiten.
Dr. Thomas Kerscher vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Niederbayern freute sich über das IEK, , schließlich fördere sein Amt das Projekt mit 70 Prozent.
Das IEK enthalte einen Maßnahmenkatalog mit Leuchtturmprojekten und einen Zeitund Finanzierungsplan von 2014 bis 2018, sagte Pauli. Die Projektanalyse zeige auf, dass insbesondere beim Wärmeverbrauch in den Haushalten, aber auch beim Stromverbrauch Einsparpotenziale und durch Umstellung auf erneuerbare Energien eine große Wertschöpfung möglich sei. Am Beispiel von Thurmansbang verdeutlichte Pauli, wie dies zu erreichen sei. Aber er machte auch die Verantwortung der Kommunen deutlich: „Es ist Ihre Entscheidung, was noch herausgeholt werden soll“.
Der auf fortschreibbaren Daten basierende Maßnahmenkatalog enthalte wirtschaftlich sinnvolle, realisierbare Vorschläge, die einzeln oder im Verbund umzusetzen seien, wie er am Beispiel der Wasserkraft erläuterte. Den Bedenken der Mandatsträger, ob es sich da nicht um ein „Wunschkonzert“ handle, entgegnete er, das dafür sicher auch ein Umdenken bei den Genehmigungsbehörden erforderlich sei. „Es wird kein leichtes Unterfangen“, wenn auch alle Vorschläge mit dem Wasserwirtschaftsamt vorbesprochen seien, betonte Pauli.
Der Maßnahmenkatalog gliedere sich in die sechs Handlungsfelder Energiemanagement, energetische Bauleit- und Raumplanung, Energieberatung und Bewusstseinsförderung, Einsparung und Effizienz, energetische Sanierung und schließlich Ausbau erneuerbarer Energien. Am Anfang stehe die kommunale Umsetzung des „IEK“ Technologie-Campus Freyung stellt Integriertes Energiekonzept vor durch die Bestellung eines Energiemanagers und kommunaler Energiebeauftragter, welche den Entwicklungsprozess kontinuierlich anstoßen und begleiten. Eine wichtige Funktion habe dabei auch die Fortschreibung und Kontrolle der Energiebilanz. Dazu müsse sich jede Kommune Ziele setzen.
Einen Schwerpunkt stelle künftig die energieorientierte Bauleit- und Raumplanung dar, um gezielt Flächen für Energiekonzept auszuweisen. Damit einher gehen müsse ferner eine breite Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung.
Eine Hilfe für finanzschwache Kommunen könne etwa ein interkommunales Sanierungsmanagement sein, wofür alle in einen gemeinsamen Finanzierungspool einzahlen. Beim Ausbau der erneuerbaren Energiegewinnung sollte alle aufgezeigten Möglichkeiten einer vorbehaltslosen Prüfung unterzogen werden. „Sie entscheiden, wir können nur empfehlen“, machte Pauli abschließend unter dem Applaus der Anwesenden nochmals deutlich.
Abschließend wurden die notwendigen Empfehlungsbeschlüsse, die Köberl vortrug, einstimmig gefasst. Die weitereWeichenstellung sei schließlich jeder Kommune überlassen, so Köberl. Das endgültige Konzept werde den Kommunen voraussichtlich am 25. März bei einer Abschlussveranstaltung überreicht.
Quelle: PNP vom 1. Februar 2014
Foto: Thurnreiter

Bionik: Projekttag und Vortrag am TCF widmeten sich diesem Thema
Die Bionik hat ein klares Ziel: Das Lösen technischer Fragestellungen durch die Übertragung von Erkenntnissen aus der Natur. Wenn dann noch der Aspeki der Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, spricht man auch gerne von Biomimicry. Was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt, konnten kürzlich 20 Schüler des Gymnasiums Freyung sowie rund 50 interessierte Zuhörer aus Unternehmmen und der Öffentlichkeit am Technologie Campus Freyung erfahren.
Der Förderverein Technologie Campus Freyung e.V. hat es ermöglicht, dass Dr. Arndt Pechstein, Gründer von Biomimicry Germany, aus Berlin nach Freyung kam. In einem Projekttag für Schüler konnten diese nach einem - im wahrsten Sinne des Wortes - Ausflug in die Natur an technischen Fragestellungen arbeiten. In kürzester Zeit hatten die teilnehmenden Schüler Ideen für Aufgaben erarbeitet, die zum Teil tatsächlich aus Industrieprojekten stammten. Das Ergebnis der Schüler war erstaunlich, denn dank ihrer Kreativität sind sie spielerisch auf Lösungen gekommen,an denen Firmen zum Teil sehr lange arbeiteten. Am Abend setzte sich dann die Bionik-Vortragsreihe fort und Dr. Pechstein gab einen Einblick in revolutionäre Innovationen nach dem Vorbild der Natur. Der Förderverein Technologie Campus Freyung e.V unterstützt seit dem Bestehen die wissenschafdiche Arbeit am Technologie Campus Freyung in vielfältiger Weise.


Ilzer Land setzt auf das von TC Freyung erarbeitete integrierte Energiekonzept – Erste Vorstellung
Es zeichnet sich ab, dass die rund 70 000 Euro für die Erstellung eines Integrierten Energiekonzeptes für die Ilzer Land- Gemeinden durch den Technologie Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf bestens angelegt sind.
„70 Prozent der Kosten trägt das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern, den Rest bringen die Mitgliedsgemeinden auf“, erklärte Dr. Christian Thurmaier vom ALE bei der Vorstellung dieses Konzeptes, für das die Berechnungen und Analysen abgeschlossen sind und aktuell mit dem TC Freyung konkrete Maßnahmen und Detailbetrachtungen entwickelt werden.
Vor dem Abschluss des Endberichts wurden die bisherigen Ergebnisse mit abgeleiteten Maßnahmen den Kommunen Fürsteneck, Perlesreut, Ringelai und Röhrnbach in der Josef-Eder-Halle in Röhrnbach präsentiert. Die gleiche Vorstellung erfolgt am 22. Januarum18 Uhr für dieKommunen Grafenau, Saldenburg, Schönberg und Thurmansbang in der Festhalle in Thurmansbang.
„Was bringt das Energiekonzept im Ilzer Land in barer Münze?“, unter diese Thematik stellte Josef Pauli, der technische Leiter des TC Freyung, der mit Raphaela Pagany und Florian Diepold diese Präsentation vorbereitet hatte. Sämtliche Umsetzungsmöglichkeiten wurden geprüft, die von 2014 bis 2018 realisiert werden können. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass nicht der Strom der größte „Energiefresser“ ist, sondern die Wärme.
Josef Pauli kündigte an, dass jede beteiligte Kommune bei der Abschlussveranstaltung im März eine detaillierte Auflistung über die Stromstrategie wie auch die Wärmestrategie erhält. Alles untermauert mit Kartenmaterial und Ergebnissen der vielen durchgeführten Messungen.
Im Zuge der Erstellung des Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) wurden Maßnahmen als Basis für konkrete Energienutzungsaktivitäten im gesamten Ilzer Land erarbeitet. „Deren Umsetzung kann nur mit Zustimmung der einzelnen Kommunen im Gemeindeverbund geschehen. Für die Kommunen ist das IEK eine gute Chance, die Energiewende im eigenen Verwaltungsgebiet voranzubringen“, erklärte Josef Pauli.
Den Kommunen des Ilzer Landes wird an Aktivitäten empfohlen, dass kommunale Vertreter eine Orientierung am IEK beschließen, einen kommunalen Energiebeauftragten bestimmen und eine Umsetzung der im IEK gefassten Maßnahmen anstreben. Ziel sei es, so Josef Pauli, dass Maßnahmen und Idee sowohl im gesamten Gemeindeverbund als auch auf kommunaler Ebene koordiniert und umgesetzt werden.
Für die Umsetzung schlug Josef Pauli einen Beschluss durch die Kommunalvertreter vor, in den jeweiligen Kommunen die Wahl des Energiebeauftragten anzustreben.
Der Beginn der Umsetzungsphase setzt eine regelmäßige Abstimmung aller kommunalen Energiebeauftragten und einem Energieprojektmanager vor.
Dieser neutrale und unabhängige Energieprojektmanager sollte an zentrale Stelle des Ilzer Landes eingestellt werden, um Projekte im gesamten Gemeindeverbund, unter anderem Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem IEK, anzustoßen. Der Projektmanager initiiert und koordiniert einzelne Projekte als „Kümmerer“ und er ist zugleich Ansprechpartner und zentrale Informationsstelle für kommunale Energiebeauftragte. „Er soll weiter als Netzwerker fungieren, Bürger mit umsetzenden Stellen zusammenführen und über anstehende Projekte frühzeitig Aufklärungsarbeit leisten und Fördermöglichkeiten als weitere Aufgabe auskundschaften“, betonte Josef Pauli.
Dies soll garantieren, dass Maßnahmen und Ideen auch tatsächlich weiter vorangetrieben und realisiert werden. Leistungen, die von einzelnen Gemeinden in Anspruch genommen werden, sollen einen Anteil der Grundfinanzeirung sichern.
In jeder Kommune soll ein kontinuierlicher Ansprechpartner für die interne Projektbegleitung zur Verfügung stehen und zur interkommunalen Kommunikation beitragen. Für seine beratende Tätigkeit muss der Energiebeauftragte nicht zwingend über Fachwissen verfügen, soll jedoch die Gelegenheit für Fortbildungen erhalten.
Röhrnbachs 1. Bürgermeister Josef Gutsmiedl hatte die Tagung als federführender Bürgermeister des Handlungsfeldes „Energie“ eröffnet, Bürgermeister Max Köberl ließ in gleicher Funktion abschließend über den Empfehlungsbeschluss zur Umsetzung der Maßnahmevorschläge abstimmen wie auch über die Bestellung eines interkommunalen Energiemanagers und die Bestellung von kommunalen Energiebeauftragten. Diesen wurde zugestimmt, werden jedoch erst wirksam, wenn die Kommunen Grafenau, Saldenburg, Schönberg und Thurmansbang damit einverstanden sind.
Ilzer Land-Vorsitzender Manfred Eibl, 1. Bürgermeister der Gemeinde Perlesreut, dankte dem ALE, TC wie auch den federführenden Bürgermeister Josef Gutsmiedl und Max Köberl für das Engagement und die umfangreiche Arbeit für das IEK
Quelle: PNP vom 20. Januar 2014
Autor: Norbert Peter

Ein dicker Ordner als Weihnachtsgabe
Jahresschluss-Sitzung des Kreistags: Kreis und Gemeinden bekommen den Energienutzungsplan überreicht. Gestecke auf den Tischen, brennende Kerzen, kleine Schoko-Nikolause - wie gewohnt ging die letzte Kreistagssitzung des Jahres in einem adventlich dekorierten Sitzungssaal über die Bühne. Und dazu gab es diesmal auch ein „Christkindl" für Landrat Michael Adam und die Bürgermeister unter den Kreisräten. Drei Wissenschaftler von der Technischen Hochschule Deggendorf hatten es mitgebracht - sie überreichten nach jahrelanger Vorarbeit den Energienutzungsplan in Form eines Ordners plus Karten-Broschüre.
Prof. Wolfgang Dorner umriss noch einmal kurz, worum es bei dem Projekt gegangen war, das Landkreis mit Gemeinden bei der TH in Auftrag gegeben hatten. Im Hintergrund stehen die Stichworte Klimawandel und Energiewende - „aber letztlich", meinte Dorner, „geht es um Euro." Euro, die in den Kassen von Kreis, Gemeinden und Bürgern bleiben, wenn weniger Energie verbraucht bzw. mehr- Energie regenerativ erzeugt wird. Dorner nannte als Ziel „die Veränderung eines Wirtschaftszweiges". Er und seine Leute sind zu dem Schluss gekommen, dass im Gebiet des Landkreises Regen der gesamte Energiebedarf selbst erzeugt werden kann, nur bei der Wärme fehlen sieben Prozent. Voraussetzung: Der Einstieg in die Windstromerzeugung kommt.
Wie dieser Umstieg im Detail funktionieren kann, das haben die TH-Leute in detaillierten Vorschlägen und in Karten sowie in digitalen Dateien zusammengetragen - das Paket bekamen Landrat mit Bürgermeister in der Sitzung überreicht. Dass die ganz große Euphorie der Zeit nach dem Atomausstiegs-Beschluss vorbei ist, das nimmt Dorner gelassen. „Es stimmt, der Hype ist vorbei", sagte er, aber die Veränderung sei schon erfolgt; jetzt komme die Zeit der konsequenten Umsetzung. Ein Jahr im Rückblick
In den Ansprachen, die traditionsgemäß die Advents-Sitzung beschließen, stand ein Thema im Vordergrund: Die neu gegründete Arberland REGio GmbH. Landrat Adam nahm deren Zustandekommen als Beleg für das gute Arbeitsklima im Kreisrat. „Ich bin stolz darauf, dass wir für die GmbH alle Kreisräte gewonnen haben", sagte Adam, „diese konstruktive Arbeiten unterscheidet uns von anderen Kreisen - wo man sich oft einfach eine Mehrheit sucht und dann durchmarschiert." Ausdrücklich wandte sich Adam gegen Vorwürfe, der Kreistag gebe mit der GmbH Einfluss und Verantwortung in wichtigen Bereichen an die Wirtschaft ab. „Das ist Unsinn, wir haben künftig sogar mehr Kontrolle als bisher."
Adam zählte Glanzlichter des Jahres 2013 auf: Den Umbau des Viechtacher Krankenhauses, die Neubesetzung des Krankenhaus-Vorsitzes mit Christian Schmitz, die Verstaatlichung des Frauenauer Glasmuseums, die Zusage eines Probebetriebs für die Bahnlinie Gotteszell-Viechtach. Der OPNV gehöre aber auch zu den „Baustellen", stellte der Landrat klar. Ebenso wie die Zukunft der Regener Eishalle - hier betonte Adam einmal mehr, dass die Initiative von der Stadt Regen ausgehen müsse. Willi Köckeis, Sprecher der CSU-Fraktion, attestierte dem SPD-Landrat, dieser nehme auch Argumente der CSU auf. Und er erinnerte zugleich daran, -wie wertvoll es sei, einen engen und fleißigen Minister wie Helmut Brunner im Landkreis zu haben.
Franz Köppl lobte für die SPD die kollegiale und zielgerichtete Zusammenarbeit. Und er betonte, man erwarte sich viel von der Zusammenführung von Wirtschafts- und Tourismusförderung in der Kreis-GmbH.
Publicity wider Willen
Otto Pfeffer (FW) konnte Adam den Seitenhieb nicht ersparen, der Landkreis sei heuer „ungewollt in allen Medien vertreten" gewesen. Pfeffer rechnet damit, dass sich die Finanzsituation des Kreises verschlechtern wird. Und in Sachen Eishalle sieht er einen Zweckverband als einzige Lösung. Heinrich Schmidt (Unabhängige) nannte als Aufgaben für die Zukunft das Erhalten der Krankenhäuser und den Ausbau der Breitbandversorgung - um die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten.
Günther Iglhaut (ödp) freute sich , dass einige alte ödp-Projekte Gestalt annehmen: Kreis-GmbH, Energiemanager, ÖPNV-Gesamtkonzept. Nach den Schlagzeilen um Adam, so wünschte sich Iglhaut, müsse der jetzt dafür sorgen, dass wieder Ruhe einkehrt.
Sie könne nicht so viel Lob verteilen wie ihre Vorredner, meinte Sigrid Weil g (Grüne) - weshalb sie sich ihre inhaltliche Stellungnahme gleich für die Haushaltssitzung sparen wolle. Immerhin sprach sie stellv. Landrat Willi Killinger ihren Respekt aus, dieser habe wieder einmal eine schwierige Lage souverän gemeistert und Schaden vom Landkreis abgewendet. Landrat Adam riet sie zu Stunden beim Kreissportbeauftragten - und fairen Umgang mit dem Gegner zu erlernen. Werner Stahl (FDP) nannte den Erhalt der Krankenhäuser als zentrales Thema - er mahnte aber auch, die Kritik an der derzeitigen Nationalparkpolitik („Waldvernichtung mit Steuermitteln") dürfe nicht einschlafen.

Förderverein Technologie Campus Freyung hat neuen Vorstand gewählt.
Seit Bestehen des Technologie Campus Freyung unterstützt der 2009 gegründete Förderverein Technologie Campus Freyung e.V. sehr erfolgreich die Aktivitäten der einzelnen Arbeitsgruppen.
Der Förderverein wird von rund 100 Mitgliedern getragen, welche damit ihre Verbundenheit zum Technologie Campus Freyung und der THD sowie zur ganzen Region ausdrücken. Die Projekte, die bisher unterstützt wurden, sind sehr vielfältig und reichen von Projekttagen für Schüler über Summerschools bis hin zu technischer Ausstattung der Labore. Auch Fachvorträge für die interessierte Öffentlichkeit konnten durch den Förderverein bereits erfolgreich angeboten werden.

Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich zeigte sich in seinen Grußworten erfreut über die positive Entwicklung am Campus in Freyung und betonte die Bedeutung des Fördervereins für die Unterstützung des Campus und der ganzen Region.
Nach der Versammlung folgte ein Vortrag aus der Reihe „Hochschule hier und jetzt“, die der Förderverein seit Beginn seines Bestehens organisiert. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Bionik am Campus, Dipl.-Biol. Kristina Wanieck, referierte zum Thema „Faszination Bionik – Innovation und Nachhaltigkeit durch das Lernen von der Natur“.

Energienutzungsplan: Jetzt geht es in die Gemeinden
Jetzt wird es sich entscheiden, ob die vielen tausend Seiten mit Analysen und Berechnungen, mit Diagrammen und Empfehlungen konkrete Folgen haben werden - oder ob sie unbeachtet in irgendeiner Ablage vergammeln. Der Energienutzungsplan für den Landkreis Regen ist erstellt, jetzt muss sich zeigen, welche Schlüsse daraus gezogen werden, ob gehandelt wird.
"Aus dem Thema Energiewende ist etwas die Luft raus", stellte Landrat Michael Adam bei der Abschlussveranstaltung zum Energienutzungsplan fest. Dass sich das ändert, dafür will er sorgen, und er verkündet, dass die gerade eben gegründete ArberLand REGio GmbH dieses Feld beackern soll. "Wir brauchen Kümmerer", so Adam. Kümmerer auf Kreisebene soll Herbert Unnasch sein, Geschäftsführer der neuen Kreis-GmbH.
Erstellt hat den Energienutzungsplan der Technologie Campus Freyung der Technischen Hochschule Deggendorf. Dipl.- Ingenieur Josef Pauli vom Campus Freyung stellte einige Fakten am Beispiel der Stadt Regen vor. 254 000 Megawattstunden Wärmeenergie werden in Regen pro Jahr verbraucht, 80 Prozent dieser Energie wird mit Öl oder Gas erzeugt, 20 Prozent mit Hilfe von erneuerbaren Energien. Konnten diese 80 Prozent durch regenerative Energien ersetzt werden oder ein Teil durch Einsparungen überflüssig gemacht werden, so konnte eine jährliche Wertschöpfung von rund zwölf Millionen Euro erreicht werden, wie Pauli erläuterte. 47 Vorschläge sind im Energienutzungsplan für die Stadt Regen gemacht worden. Die reichen von so simplen Dingen wie der Schulung von Hausmeistern bis zu komplexeren wie der Änderung von Flächennutzungsplanen, über den Bau von PV-Anlagen zu ermöglichen. Oder dem Bau von Blockheizkraftwerken, die ganze Siedlungsteile mit Wärme versorgen können und nebenbei noch Strom erzeugen.
Auch Pauli sagte, dass es in den Städten und Gemeinden einen festen Ansprechpartner geben müsse, der sich hinter diese Projekte klemmt. Wie so ein Ansprechpartner aussehen kann, das zeigte Peter Ranzinger aus Passau. Er ist der Ober-Energie-Einsparer des Landkreises Passau. Genauso beeindruckend wie seine sprühende Energie waren die Fakten, die er brachte. Dass Energiesparen nötig ist, um den Klimawandel zu bremsen, das kann ein Motiv sein. Das wichtigere Motiv für viele ist aber, den eigenen Geldbeutel zu retten. Gegenwärtig werden im Landkreis Passau jährlich 900 Millionen Euro pro Jahr für Energie ausgegeben, in selben Jahren werden es wegen der Preissteigerung rund 1,5 Milliarden Euro sein. Da kann sich Energiesparen schnell lohnen, und mögliche Mehrkosten für energiesparende Technik amortisiert sich schnell.
Ranzinger räumte auch mit dem Irrglauben auf, dass der steigende Strompreis der große Preistreiber ist. "Nur zwölf Prozent des Energieverbrauchs entfallen auf Strom, 46 Prozent entfallen auf Warme, der Rest wird für die Mobilität verbraucht", sagte er. Und formulierte gleich das große Ziel: Leute motivieren, an der Energiewende mitzuarbeiten. Nach dem schwedischen Wirtschaftsnobelpreisträger und Soziologen Gunnar Myrdal kann ein gesellschaftliches Projekt durchgesetzt werden, wenn es nur von fünf Prozent passionierter Menschen zielstrebig und ausdauernd verfolgt wird.
Quelle: PNP vom 5. Dezember 2013


In Zenting war die Auftaktveranstaltung zur Erstellung eines Energienutzungskonzepts.
Es lag sicher nicht allein an der guten Belüftung während der Pause, dass die rund 20 Zuhörer über zwei Stunden höchst aufmerksam und interessiert die Ausführungen der Referenten anlässlich der Auftaktveranstaltung zur Erstellung eines Energienutzungskonzeptes durch die Gemeinde Zenting im Gasthaus „Alter Wirt“ verfolgten.
Dipl. Ing. Josef Pauli vom Technologie Campus Freyung gab ganz konkrete Beispiele für ein „Sparen durch bewusstes Handeln“. Die Zuhörer sollen nun als Multiplikatoren die übrige Bevölkerung zur Mitarbeit in den nachfolgenden Energiewerkstätten bewegen.
„Es hätten durchaus mehr sein können“, resümierte Bürgermeister Leopold Ritzinger über den Besuch der Auftaktveranstaltung, zu der er „hochkarätige“ Referenten begrüßte. So waren Professor Dr. Wolfgang Dorner und Cornelia Greichen von der Technischen Hochschule Deggendorf, Dipl. Ing. Josef Pauli und Florian Diepold – der durch den Abend führte – vom TC Freyung sowie vom Ing. Büro Nigl+Mader, Thomas Mader und Mathias Obermeier, gekommen.
Gruß und Dank galten auch Dr. Thomas Kerscher vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE), welches die Gemeinde Zenting als eine von 17 Kommunen in Niederbayern – zusammen mit der Nachbargemeinde Schöfweg – in das Programm „100 energieautarke Gemeinden“ aufgenommen habe.
Er,Ritzinger, sehe es als eine Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen im Rahmen der Energiewende den Bürgern Wege für einen sparsameren Energieverbrauch und für Investitionen auf dem Energiesektor aufzuzeigen. Auch für die kommunalen Einrichtungen sah er viele Ansatzpunkte. Seine Vision sei es, Gemeinde, Betriebe und Bürger „so energieautark aufzustellen als möglich“. Ein weiterer Glücksgriff sei sicher auch, so Ritzinger, dass mit der Dorferneuerung Zenting Synergieeffekte nutzbar werden.
Zunächst stellte Mader sein Büro vor. Im sogenannten „Dreisprung“ – Energieeinsparung, Effizienzsteigerung und erneuerbare Energien – wolle man zur Umsetzung der Energiewende beitragen.
Die Vorarbeiten dazu liefere der TC Freyung mit einem Team von 40 Mitarbeitern, so Professor Dorner. Am Beispiel des Ölpreis-Verlaufs zeigte er die Brisanz dieses Faktors für die Zukunft auf. Die langen Laufzeiten der Kernkraftwerke und der Förderprogramme erforderten langfristige Investitionen, wobei ein Zeithorizont von 20 bis 30 Jahren anzusetzen sei.
Die Staatsregierung habe daher mit dem erwähnten „Dreisprung“- Verfahren eine politische Vorgabe gemacht, deren Umsetzung vor Ort jedoch in der Entscheidung der Kommunen und ihrer Bürger liege. Die Technologie sei vorhanden. Es sei aber auch der Wille notwendig, diese einzusetzen, betonte Dorner. Der Energienutzungsplan diene dazu, Leitlinien und Visionen zu entwickeln.
Das Verfahren zur Entwicklung dieses Energiekonzeptes zeigte Diepold auf. „Als Ergebnis sollen konkrete Maßnahmen stehen, die umsetzbar sind und eine realistische Strategie für die Zukunft beinhalten“. Eine große Bedeutung komme dabei der Bürgerbeteiligung zu. Nach den bereits erhobenen Daten sah er in der Gemeinde Zenting „eine gute Ausgangslage“ gegeben, da bereits ein weit über dem Durchschnitt liegender Strombedarf durch erneuerbare Energien erzeugt werde.
Dann ging Pauli ins Detail. An Beispielen zeigte er auf, was das Energiekonzept jedem persönlich bringt und wie man durch bewusstes Handeln Energie und damit Geld sparen kann, um damit einmal mehr zum Mitmachen zu bewegen.
Durch eine bedarfsgerechte Anpassung seien bei der Heizung Einsparungen möglich. Je nach technischer Begabung könne man diese selbst vornehmen oder durch Fachfirmen vornehmen lassen. Aber allein schon durch das Herablassen der Rollos werde die Wärme länger im Raum gehalten. Die dadurch mögliche Einsparung bezifferte Pauli auf rund 300 Euro jährlich. Weiter ging er auf Einsparmöglichkeiten beim Stromverbrauch ein. Ebenso viel könne man bei Haushalts- und Unterhaltungsgeräten sparen, schon wenn man auf den Standby-Modus verzichte. Auch LED-Beleuchtung bringe mitunter auf längere Sicht eine Kosteneinsparung, erläuterte Pauli.
Der Bürgermeister hofft auf eine „Eigendynamik“ in der Bevölkerung, welche das Projekt gut voranbringe. Im Januar soll zu Workshops eingeladen werden und im Juni nächsten Jahres das Ergebnis vorliegen.
Quelle: PNP vom 3.12.2013

Arbeitsgruppe Angewandte Energieforschung - Energienutzungsplan und Energiekonzept
Im Rahmen des Energie-Atlas Bayern - Klimaschutz und Energiewende beteiligte sich die Arbeitsgruppe "Angewandte Energieforschung" an den Veranstaltungen „Energienutzungsplan und Energiekonzept“.
Die vom Landesamt für Umwelt zusammen mit der Regierung von Niederbayern und ENERGIE INNOVATIV durchgeführten Veranstaltungen richteten sich an Gemeinden, Märkte und kleinere Städte, um die Schlüsselfunktionen der Kommunen in der Energiewende vor Ort aufzuzeigen und zu diskutieren. In den Regierungsbezirken Nürnberg, Bayreuth, Würzburg, Erding, Amberg und Niederalteich begleiteten Josef Pauli, technischer Leiter der Arbeitsgruppe Angewandte Energieforschung, sowie seine Mitarbeiter Anna Marquardt, Florian Diepold, Andreas Scheueregger und Raphaela Pagany als Experten die Diskussionen. Zu den ausführlich diskutierten Themen zählten Potenzialanalyse, Konzeptentwicklung und Öffentlichkeitsbeteiligung, wobei wichtige Fragen in Kleingruppen intensiv diskutiert und gemeinsam die Weichen für die Zukunft gestellt werden konnten.

Solarpotenziale mit GIS erschließen.
Die Arbeitsgruppe Angewandte Energieforschung beteiligte sich am vergangenen Mittwoch, den 06.11.2013, am „Internationalen GIS Day“, der in Linz stattfand.
Bei diesem weltweit stattfindenden Tag der offenen Tür konnten sich Schüler über Geografische Informationssysteme (GIS) und deren Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen informieren. In Linz nahmen insgesamt 19 Schulklassen mit 443 Schülern und 23 Lehrern teil, die sich auf verschiedene Workshops verteilten. Anna Marquardt und Andreas Scheueregger vom Technologie Campus Freyung informierten die Schüler über den Einsatz von GIS für die Erschließung von Solarpotenzialen.

Das Energiekonzept der Jugend.
Warum sollen immer nur Erwachsene entscheiden wie die Energiewende zu gestalten ist – vor allem, wenn die Entscheidungen von heute die Generationen von morgen betreffen? Deshalb trafen sich am Mittwoch, den 6.11.2013 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 der Mittelschule Grafenau mit Raphaela Pagany und Florian Diepold vom Technologie Campus Freyung sowie mit Magdalena Schwarz, Studentin der Technischen Hochschule Deggendorf.
Gemeinsam werden sie in den nächsten drei Wochen Leitlinien und konkrete Maßnahmen für die Energiewende vor Ort erarbeiten und dann dem Grafenauer Stadtrat und Vertretern des Amtes für ländliche Entwicklung präsentieren. Anlass dazu gibt die parallele Erstellung des Energienutzungskonzepts für das Ilzer Land, bei dem mit Hilfe einer umfangreichen Bürgerbeteiligung eine Energiestrategie für die Zukunft der Region entstehen soll. Der aktive Einbezug von Jugendlichen bei der Ausgestaltung von Energiekonzepten ist in dieser Form bisher einzigartig in Deutschland.

Martin Muller entwickelte ein Multimeter.
Ein Multimeter ermöglicht Elektrotechnikern das Vermessen von Standardbauteilen wie z.B. Widerständen und Dioden. Auch Spannungen und Ströme konnen mit dem Gerät gemessen werden. Martin Müller, erster Auszubildender am Technologie Campus Freyung, hat in seiner Projektarbeit zusammen mit Jutta Wirthmüller, Auszubildende an der Technischen Hochschule Deggendorf, alle Stufen einer solchen Entwicklung eigenständig erarbeitet und als Ergebnis nicht nur an der Berufsschule Deggendorf die Bestnote 1,0 erhaIten, sondem auch ein funktionsfahiges Multimeter gebaut.
Das besondere an seiner Entwicklung ist eine direkte visuelle Darstellung aller Vermessungsarten. Seine Projekarbeit ist ein Beispiel dafur, welche Möglichkeiten sich in der Lern- und Modellfabrik des Fachbereichs Embedded Systems bieten. Kundenindividuell können Kleinserien und Prototypen von der Grundidee über Konzeption und Umsetzung bis zum fertigen Produkt hergestellt werden. Und das in dem einmaligen Zusarnmenarbeiten mit den Wolfsteiner Werkstätten.
Das entworfene Multimeter soil in Zukunft zu Lehr- und Vorführzwecken genutzt werden. „Bei einer Ausbildung und vor allem bei meiner Projektarbeit gefällt mir am besten, dass ich die Freiheit habe, eigenständig Entwicklungen zu machen", so Martin Müller über seinen Erfolg.
Quelle: Passauer Neue Presse vom 05. August 2013

Klimaschutzkonzept für Landkreis steht–Aktionsplan: 50 Maßnahmen bis 2017–Von Energiemobil bis Passivhaus.
Die Zeit der Arbeit im stillen Kämmerlein ist vorbei. Das Klimaschutzkonzept für den Landkreis Passau ist erarbeitet, die Ziele sind grundsätzlich abgesteckt. Jetzt geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse unters Volk zu bringen und – was noch wichtiger ist − die Menschen zu einem Beitrag zu bewegen.
Das war die klare Botschaft bei einer Info-Veranstaltung am Donnerstagabend beim „Kirchenwirt“, die zum einen den Abschluss der Konzept-Erstellung und zum anderen den Auftakt für die Umsetzung markieren sollte. Das Interesse war groß, der Saal gut gefüllt – vor allem mit Vertretern der 37 beteiligten Kommunen, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Landrat Franz Meyer, der die Versammlung eröffnete, zeigte sich stolz auf die Initiative und stellte heraus, dass rund 125 Experten aus der Region beigetragen haben, dieses Klimaschutzkonzept zu entwerfen: „Wenn wir etwas machen, dann richtig. Und so haben wir heute bei den Landkreisen in Bayern auch im Bereich Klimaschutz eine Vorbildrolle.“ Er dankte den Mitwirkenden und forderte sie auf, weiterhin mit Engagement mitzuwirken.
Berater kommen zu den Bürgern
Dieses Engagement wird auch dringend nötig sein. Denn „jetzt geht die Arbeit richtig los“, erklärte Peter Ranzinger von der Stabsstelle Klimaschutz am Landratsamt, die bei diesem Projekt die Fäden zieht. In Stichpunkten zählte er auf, was sich die Akteure vorgenommen haben. War es bisher so, dass die Bürger zur Beratung ans Landratsamt gekommen sind, so werden die Berater künftig zu den Bürgern gehen–und zwar mit einem Energiemobil. Man werde Leitlinien zusammenstellen, die beim Bauen und Sanieren helfen, die Kommunen unterstützen bei der Bauleitplanung und bei Neuanschaffungen, ein Einkaufsportal einrichten zur Umrüstung auf LED-Leuchten und versuchen, die Vorurteile gegen Windkraftanlagen abzubauen. Im Gespräch ist auch, ein Passivhaus zu bauen, das den Bürgern als Anschauungsobjekt dient. Die Kommunen sollten Beauftragte an den Verwaltungen ernennen, die sich federführend um das Thema Energie kümmern und sich untereinander vernetzen. Jede Kommune sollte für sich einen „Mini-Aktionsplan“ aufstellen, der ein Projekt im Jahr vorsieht, das dann auch ganz konkret umgesetzt wird. Ganz wichtig, so Ranzinger, ist vor allem auch die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit.
Zuvor hatten die Zuhörer Zahlen, Fakten und Hintergründe zum Klimaschutzkonzept erhalten. Willi Steincke von der KlimaKom eG Kommunalberatung und Matthias Heinz von der GreenCity Energy AG, die in das Projekt eingebunden waren, skizzierten Vorgehensweise und Erkenntnisse. Man habe eine gute Ausgangslage vorgefunden, konstatierte Steincke. Die Region ist mittlerweile für das Thema sensibilisiert. Es gibt eine Stabsstelle. Und vor allem im Bereich der Erneuerbaren Energien sind schon viele Projekte umgesetzt worden. Bei den energetischen Sanierungen dagegen hätten sich bisher hauptsächlich die Kommunen engagiert. Künftig brauche es aber die Unterstützung möglichst aller – von Unternehmern, von sanierungswilligen Hausbesitzern und von konsumbewussten Bürgern. Wenn man das anvisierte Ziel erreichen wolle, müsse das Potenzial auf allen zur Verfügung stehenden Handlungsfeldern ausgeschöpft werden. Im Klimaschutzkonzept sei deshalb ein Aktionsplan mit 50 Maßnahmen definiert, die von 2013 bis
Sonne, Wind und Sanierungen
Matthias Heinz wartete mit Zahlen auf: Der Landkreis-Bürger verursache pro Jahr eine CO 2-Emission von 10,7 Tonnen – mehr als im Bundesdurchschnitt (9,8 Tonnen). In erster Linie sei dieser hohe Wert dem Verkehr geschuldet. Dieser habe hier auch den größten Anteil an den Emissionen, nämlich 47 Prozent, gefolgt von Wärmeverbrauch (39) und Stromverbrauch (14). Wenn man nun den CO2-Ausstoß um die Hälfte verringern wolle, würden die drei Handlungsfelder Sonne, Wind und Häusersanierungen die meisten Kapazitäten bieten. „Hier wäre eine Minderung um zwei Drittel zu schaffen“, sagte er. Dies aber nur, wenn man alle „Jetzt geht die Arbeit richtig los“ Klimaschutzkonzept für Landkreis steht–Aktionsplan: 50 Maßnahmen bis 2017–Von Energiemobil bis Passivhaus Bereiche angehe. Würde man z.B. die Windkraft außen vor lassen, müsste man in den beiden anderen Bereichen umso mehr erreichen. Und da stelle sich ja irgendwann die Frage, ob das realistisch ist. Dies müsse man immer berücksichtigen. Deshalb seien alle CO2-Minderungspotenziale wichtig. Vor allem den Bereich Häusersanierungen müsse man zügig vorantreiben. Im Rahmen des Konzepts ist auch ein Neun-Punkte-Plan aufgestellt worden. Die Inhalte präsentierten Vertreter des Technologiecampus Freyung an Stellwänden: unter anderem bestehendes Klimaschutzmanagement und Controlling-System ausbauen; Kommunen vernetzen; Einsparungs- und Effizienzpotenziale gezielt nutzen; energetische Sanierung, energieoptimiertes Bauen sowie entsprechende Bauleitplanung fördern. Dabei konnten die Veranstaltungsteilnehmer mehrere Vorschläge bewerten, mit welchen Mitteln die neun Punkte am besten zu schaffen sind. Gefragt warenauch Vorschläge für ein Maskottchen, das den Klimaschutz im Landkreis Passau symbolisieren soll. Ein bisschen Zeit, das richtige Motiv zu finden, bleibt noch: Im Oktober wird der Passauer Kreistag endgültig über den Aktionsplan 2013 bis 2017 entscheiden.
Quelle: PNP vom 06.07.2013
Autor: Karin Mertl


Im WUT-Ausschuss: Umfangreiche Informationen zum Energienutzungsplan und zum Regionalplan Wind
Umsetzung des Energienutzungsplanes mit Verbrauchsanalysen für Strom und Wärme, Leuchtturmprojekten, energetischer Bewusstseinsbildung und Beratung, und dazu ein aktueller Sachstandsbericht zum Regionalplan Wind: Jede Menge aktueller Informationen gab es für die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Tourismus (WUT) bei der jüngsten Sitzung im Landratsamt.
Los ging es mit dem Energienutzungsplan, den Professor Dr. Wolfgang Dorner und Diplom-Ingenieur Josef Pauli vom beauftragten Technologie Campus Freyung erläuterten. „Die detaillierte Analyse ist noch nicht ganz fertig", sagte Professor Donner eingangs. Die Verbrauchsdaten für Strom und Wärme mit regenerativen Anteilen in den Landkreisgemeinden beleuchtete Josef Pauli. Sein Resümee: „Wenn nicht eingespart wird, gibt es keine Lösungen."
Gute Noten verteilte der Planer an die acht vorhandenen Nahwärmeanlagen, die effizient arbeiten. Eine Erweiterung, die mit wenig Aufwand verbunden ist, sollte sofort angegangen werden. Ferner plädierte Pauli für einen zentralen Biomasse-Umschlagplatz. Hier könnten Waldbauern, Landwirte usw. ihre regionalen Produkte regional vertreiben und zwar mit einem einfach gestalteten An- und Verkauf.
Beratung und Bewusstseinsbildung
Nächster Punkt: Energetische Bewusstseinsbildung. Mit einer neutralen, fachkundigen und praxisnahen Beratung, die im Kindergarten beginnen sollte, müssten Schulen, Vereine, Verwaltungen und die gesamte Bürgerschaft motiviert und sensibilisiert sowie mit Informationen und Tipps versorgt werden. Pauli gab sich zuversichtlich - „damit kann der Energieverbrauch spürbar gesenkt werden." Beste Erfahrungen gemacht hat der Landkreis Freyung/Grafenau mit Erstberatungsgutscheinen, die zertifizierte Energieberater für private Gebäudeeigentümer, Gewerbe und Handwerk ausarbeiten. Die Eigenbeteiligung sollte etwa 30 Euro betragen, den Rest übernehmen Landkreis oder Gemeinde. Hierzu teilte Pauli mit, im Nachbarlandkreis seien von der öffentlichen Hand 15.000 Euro bereit gestellt worden, das spätere Investitionsvolumen betrug dann 2,5 Millionen Euro.
Abschließend sprach Pauli die Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit an. Er schilderte den Ablauf an einem Beispiel: Zehn Gemeinden tun sich zusammen, zahlen anteilsmäßig in einen Pool ein, arbeiten ein Finanzierungsmodell aus Ergebnis: Nach zehn Jahren sind zehn Gebäude in zehn Kommunen saniert. Zur Umsetzung des Energienutzungsplanes würden sich dem Landkreis zwei Alternativen bieten: Umsetzungsberater, die vom Bund gefördert werden, oder Energieagenturen, bezuschusst vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Aus Kostengründen sei allerdings in beiden Fällen ein Verbund mit anderen Landkreisen erforderlich.
Mit Rückenwind Planung vorantreiben
Ebenfalls breiten Raum nahm der Regionalplan Wind ein. Regierungsdirektor Peter Schmid, an der Regierung von Niederbayern der Sachgebietsleiter für Landes- und Regionalplanung, unterrichtete die Gremiumsmitglieder über den aktuellen Sachstand. Er bekräftigte, dass der Regionale Planungsverband bei Windanlagen eine geordnete und gebündelte Entwicklung anstrebt. Im Rahmen des Anhörungsverfahren seien Trends festgestellt und auch eingearbeitet worden. So gilt nun bei Vorrang- und Vorhaltungsflächen eine Mindestgröße von 25 Hektar, auch ein Abstand zu überörtlichen Straßen wurde festgelegt. Hinzu kommen Ausschlusskriterien für Baudenkmäler, regional bedeutende touristische Einrichtungen, Sondergebiete oder landschaftlich prägende Höhenzüge.
„Auch dadurch haben sich die Vorrang- und Vorhaltungsflächen im Landkreis Regen deutlich verringert, knapp die Hälfte aller Potenzialflächen ist herausgefallen" berichtete Schmid. Den Puffer zu Nationalparkbereichen habe man aber von drei auf einen Kilometer reduziert. „Die Richtlinien sind fachlich vertretbar, die Begründungen können auch vor Gericht standhalten", meinte der Regierungsdirektor, Der Regional Planungsverband drückt aufs Tempo, noch heuer soll der Regionalplan Wind verbindlich gemacht werden. Schmid: „Die Zeit drängt, denn gerade in Sachen Windenergie wird alle paar Wochen eine neue Sau durchs Dorf getrieben."
Landrat: Kompromiss mit gutem Ergebnis
Verhaltene Kritik übte Kreisrätin Dagmar Spiewok. Zuerst sei überall gepredigt worden, wie wichtig die Windkraft für die Energiewende ist, die jetzigen Bestrebungen würden nur mehr darauf abzielen, möglichst viele Vorrang-flächen wieder heraus zu bekommen. Landrat Michael Adam entgegnete, dass man Kompromisse finden und eingehen musste. Er sprach von einem guten Ergebnis, „denn im Landkreis kann einmal mehr Windenergie produziert werden als gebraucht wird".
Quelle: Bayerwald-Bote vom 15.06.2013

Hochschule Deggendorf unterstützt Bundeswehr mit modernster Technik aus den Forschungslabors.
Im Rahmen der Sendung „ZDF-Spezial“ stand erneut die Krisenregion rund um Deggendorf im Mittelpunkt. Ausführlich wurde dabei auch über den Einsatz von Drohnen durch die Bundeswehr zur Kontrolle der Deiche berichtet.
Die Technik dafür stammt aus der laufenden Drohnenforschung der Hochschule Deggendorf, die schwerpunktmäßig am Techologie Campus Freyung durchgeführt wird.
Hier geht’s zum Beitrag.

Bionik-Kurs: Technologie Campus kooperiert mit Realschule
Freyung. Seit einigen Jahren wird den Schülern der Staatlichen Realschule das Wahlfach „praktische Biologie“ mit vielen Übungen und Experimenten angeboten. Dabei wird die Welt durchs Mikroskop betrachtet, um neue Einblicke zu gewinnen und viele weitere Versuche durchgeführt. Inzwischen ist dieses Wahlfach eine feste Einrichtung bei den 6. Klassen geworden.
Seit diesem Jahr kam als weiterer Höhepunkt der Bionik-Nachmittag dazu. Dabei wurden die Biologielehrerinnen Carmen Mühlbauer und Angelika Hemmerling tatkräftig von Kirsten Wommer unterstützt, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Deggendorf am Technologie-Campus Freyung im Bereich Bionik forscht.
Für die Realschüler galt es zu erfahren, was Bionik bedeutet und wie man sich den Fragestellungen in Versuchen nähert. Das Kunstwort Bionik, ist aus „Bio-“ (griech: Leben) und „-nik“ als Endung des Wortes „Technik“ zusammengesetzt. Diese Forschungsrichtung beschäftigt sich mit Besonderheiten in der Natur, die sich technisch nutzen lassen. Am bekanntesten ist sicherlich der Lotuseffekt sich selbst reinigender Oberflächen.
Die neugierigen Jungforscher nahmen viele Oberflächen förmlich unter die Lupe, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, warum entsprechend gestaltetes Material nicht schmutzig wird und Wasser abperlt. Tischplatten, Stühle, Radiergummi, Stifte oder auch Federmäppchen wurden überprüft. Aufmerksam wurde beobachtet, notiert und diskutiert, um das Gesehene zu verstehen. Im Vergleich dazu wurden verschiedene natürliche Oberflächen untersucht. Bei den jungen Forschern war spürbar die Lust am Entdecken geweckt worden. „Ein gelungener Start für unsere Bionik-Kurse“, freuten sich die beiden Biologielehrerinnen und Kirsten Wommer lud spontan eine besonders begeisterte und engagierte Schülerin zu einem späteren Praktikum am Technologie-Campus ein.
Im nächsten Schuljahr soll die Zusammenarbeit zwischen Technologie-Campus und der Staatlichen Realschule in Freyung intensiviert werden. Dazu sind nicht nur weitere Schüler-Workshops sondern auch Lehrerfortbildungen geplant. - dl
Quelle: Passauer Neue Presse, 13. Mai 2013

Gut besuchte Auftaktveranstaltung in der Josef-Eder-Halle - Bürger können sich einbringen und mitgestalten
Röhrnbach. Die Ilzer Land-Gemeinden haben ein gemeinsames Energienutzungskonzept beschlossen und den Technologie Campus (TC) in Freyung mit der Erstellung beauftragt. Das Thema „Energie“ ist eines der entscheidenden Zukunftsthemen - und für jede Gemeinde, aber auch jeden einzelnen Haushalt, von großer Bedeutung. Daher ist es den Initiatoren aus dem Ilzer Land besonders wichtig, von Beginn an Bürgern die Möglichkeit zu geben, dieses Konzept und damit die Zukunft der Energieversorgung ihrer Gemeinden mitzugestalten.
Bei der Auftaktveranstaltung in der Josef-Eder-Halle in Röhrnbach wurden die ersten Schritte vorgestellt. Dieser Auftakt diente zugleich als Grundlage für die nachfolgenden Regional-Workshops, in denen konkrete und aktuelle Energiethemen diskutiert sollen, um daraus eine Zukunftsstrategie für die eigene Gemeinden zu erarbeiten. Der Nutzen dieses gemeinsam erarbeiteten Energienutzungskonzepts liegt darin, Strategien und umsetzbare Ansatzpunkte für einen energieeffizienten Umgang in den Gemeinden zu erhalten und sie damit für die Herausforderungen der Zukunft zu wappnen.
„Bares“ für den
Geldbeutel
Nicht zuletzt sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, die schlussendlich „Bares“ für den Geldbeutel bedeuten.
„Hausherr“ Bürgermeister Josef Gutsmiedl, mit Bürgermeister Max Köberl aus Ringelai die Leiter des Handlungsfeldes „Energie“ der Ilzer Land-Gemeinden, erklärte einleitend, „die Kommunalallianz im Ilzer Land möchte mit der Erstellung eines interkommunal abgestimmten Energiekonzepts eine qualifizierte, systematische Erfassung und Bewertung des aktuellen Ist-Zustandes sowie der Bedarfs- und Nutzungspotenziale zielgruppenorientiert erarbeiten und die Akzeptanz für erforderliche Maßnahmen und Projekte von Beginn an fördern. Mit einer frühzeitigen Einbindung der Öffentlichkeit soll eine breite Basis für das Gelingen von nachhaltigen Maßnahmen geschaffen werden“.
Für Prof. Dr. Wolfgang Dorner, Leiter des mit der Erstellung des Energiekonzeptes beauftragten Technologie Campus Freyung, ist „Energiewende“ nicht das richtige Wort - vielmehr gehe es eine andere Form der Energienutzung, um eine Energieversorgung mit zukünftigen Problemen und Risiken, um ein Energienutzungskonzept. Tie Rohöl-e und Treibstoffpreise steigen, ein Ende der Spirale ist nicht absehbar.
Im Jahr 2021 ist das Ende der Kernkraftwerke beschlossen, 2031 läuft die EEG-Förderung für Anlagen aus dem Jahre 2011 aus. Was dann? Laut Prof. Dorner ist die politische Vorgabe der Bayerischen Energiestrategie „Energie innovativ“: Vermeidung von Energieverbrauch, Steigerung der Energieeffizienz, Ausbau der erneuerbaren Energien. Dabei sollen für eine Energieversorgung ohne Kernenergienutzung so rasch wie möglich alle in Bayern verfügbaren und zu ökonomisch wie ökologisch vertretbaren Bedingungen nutzbaren erneuerbaren Energieformen auf breiter Basis ausgebaut werden.
Dabei müssen die volkswirtschaftlich günstigen, gesellschaftlich akzeptierten und zugleich umweltverträglichen Lösungen Priorität haben. Eine einseitige Fokussierung auf einzelne der erneuerbaren Energieformen oder ein unabgestimmter Ausbau würde die ganzjährige Energieversorgungs-Sicherheit gefährden und erhebliche unnötige System-Mehrkosten verursachen. Damit würde der bereits bestehende Preisschub bei der Energiebereitstellung weiter verschärft. Stattdessen will man durch Förderung von innovativen Techniken und Mechanismen zu einer Preissenkung und vollen Marktfähigkeit erneuerbarer Energien gelangen. Deshalb soll der volks- und energiewirtschaftlich beste Mix eines umweltverträglichen und von Bürgern akzeptierten Ausbaus erneuerbarer Energien vorangetrieben werden.
Josef Pauli vom TC Freyung, Technischer Teamleiter „Angewandte Energieforschung“, erklärte, Ergebnisse durch das Energienutzungskonzept für das Ilzer Land sollen Energienetze, Energieeinkauf und -handel, Energiemanagement, Anlagenkonzepte, Kosten-Nutzen-Analyse sowie konkrete Maßnahmen zum Verringern des Energieverbrauchs in privaten Haushalten, Gewerbe/Industrie und öffentlichen Liegenschaften sein.
Die einzelnen Schritte des Energienutzungskonzeptes basieren auf der Projektvorbereitung, der Bestandsanalyse, der Energiebedarfs- und Potentialanalyse, der Konzeptentwicklung und der Umsetzung. Die energetischen Potenziale liegen in Solar, Biomasse, Wasser und Wind. Dabei werden die Bürger stets mit eingebunden, die ihre Ideen und Wünsche einbringen können.
Über die die bisherigen Ergebnisse der „energieautarken“ Region Zellertal informierte Franz Stark vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Niederbayern als dortiger Projektleiter. Ziele sind die Substitution durch regionale Energien, Klimaschutz, regionale Wertschöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
„Betroffene“ zu „Beteiligten“ machen hat im Zellertal wie auch im Ilzer Land Priorität. Durch Bürgerbeteiligung an Anlagen steigt die Akzeptanz bei Bürgern, die finanziell profitieren sollen. Die Finanzierung durch lokale Banken schafft Vertrauen. Lokale Versorger werden integriert. Ziel ist es, Wertschöpfung vor Ort zu erreichen. „Einbindung der Bürger und Gremien in entscheidungsrelevante Aspekte der Planung ist unverzichtbar“, betonte Stark.
Dr. Martin Eiberweiser, Projektkoordinator im Ilzer Land, leitete dann von der Energie im kommunalen Bereich auf Möglichkeiten der Energieeinsparung im privaten Bereich über. Über drei Irrtümer, denen man bei energiesparenden Maßnahmen an einem privaten Haus nicht erliegen sollte, berichtete der Kaminkehrermeister Richard Hettmann. Einzelmaßnahmen sind weniger komplex, „da braucht’s keinen Sachverständigen“? „Das stimmt so nicht. Jede Einzelmaßnahme verändert das Gesamtsystem „Haus“. Wer nur die Fenster austauscht und nicht darauf achtet, dass der U-Wert zur Gebäudehülle passt, riskiert Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Ein Sachverständiger kennt diese Probleme und kann Alternativen vorschlagen.
„Nur erneuerbare Energieträger wie Erdwärme oder Holzpellets machen unabhängig von steigenden Kosten“? „Falsch. Wirklich unabhängig macht nur Energie, die eingespart wird , und das gelingt vor allem durch eine bessere Wärmedämmung. Der Energieberater berechnet, in welchem Umfang der Verbrauch sinkt. Die Preise für Strom oder Brennstoffe werden immer schwanken. Auch die für Holzpellets.
„Wer richtig Energie sparen will, muss ein kleines Vermögen investieren“? „Nein, es gibt sehr viele Maßnahmen, die relativ günstig sind - wie die Isolierung von frei liegenden Heizungsrohren, die Dämmung der obersten Geschoßdecke, die richtige Einstellung der Heizung, eine hydraulischer Abgleich, neue Umwälzpumpen etc. Auch hier hilft ein Sachverständiger. Voraussetzung für eine Förderung durch die KfW ist jedoch, dass alle Arbeiten von einem Fachunternehmen ausgeführt werden.
Dr. Christian Thurmaier vom ALE Niederbayern, Projektleiter der ILE Ilzer Land, freute sich über das große Interesse an der Auftaktveranstaltung und erklärte, dass die Erstellung des Energienutzungskonzept „Ilzer Land“ mit 75 Prozent gefördert wird.
Als nächstes steht am 23. April ein Fachseminar in Neumarkt auf dem Programm unter dem Motto „Bürgerbeteiligung in kommunalen Energieprojekten“. In diesem Seminar werden erfolgreiche Bürgerenergieprojekte vorgestellt, die Handlungsempfehlungen zur Nachahmung in den eigenen Gemeinden bieten.
Quelle: Passauer Neue Presse, Norbert Peter, 16. März 2013

Pädagogischer Tag am Gymnasium Waldkirchen - Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft betont
FRG. Lehrkräfte schauen gerne über den Tellerrand und informieren sich über aktuelle Entwick-lungen. Dem Johannes-Gutenberg-Gymnasium Waldkirchen ist dabei die Partnerschaft zur regionalen Wirtschaft besonders wichtig. Es sei sinnvoll und notwendig, den Kontakt zwischen angehenden Absolventen der Region und Arbeitgebern im Landkreis frühzeitig herzustellen, ist sich die Schule sicher.
Lehrkräfte seien hierbei als Berater und Ansprechpartner eine bedeutende Schnittstelle für die Schüler. Das Regionalmanagement sieht seine Aufgabe unter anderem in der intensiven Vernetzung von Bildungseinrichtungen und der regionalen Wirtschaft. Aus diesem Grund organisierte das Regionalmanagement für das Lehrerkollegium des Johannes-Gutenberg-Gymnasiums einen Pädagogischen Tag unter dem Motto „Made in FRG“.
Dabei konnte die Schulleiterin OStDin Josefa Stamm fünf Referenten begrüßen: Ralph Heinrich (Wirtschaftsreferent FRG), Karl Kreuß (Projektkoordinator am TC Freyung), Johann Ederer (Leiter Personal Parat), Roland Biebl (Leiter Berufsausbildung ZF Friedrichshafen AG Passau) sowie Sebastian Gruber (Regionalmanager FRG).
Schulleiterin OStDin Stamm betonte, dass es „neben einer umfassenden Allgemeinbildung die Aufgabe des Gymnasiums ist, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ein Studium an Universität oder Fachhochschule, aber auch für eine qualifizierte berufliche Ausbildung vorzubereiten. Darüber hinaus haben wir der Region gegenüber die Verantwortung, intensiv auf die Auswahlmöglichkeiten und die beruflichen Perspektiven in der Region hinzuweisen“.
Der Wirtschaftsreferent des Landkreises Freyung-Grafenau, Ralph Heinrich, erläuterte aktuelle Strukturdaten (u.a. Einwohnerzahl, Arbeitslosenquote, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Pendlersaldo usw.) und zeigte die Kompetenzen bzw. ausgeprägten Wirtschaftszweige im Landkreis Freyung-Grafenau auf: „Gerade die Bereiche Metall, Kunststoff und Internet-Handel bieten für hochqualifizierte Arbeitskräfte - und somit für Absolventen der Gymnasien bzw. Hochschulen - interessante Aufgaben“, so Heinrich. „Der Landkreis Freyung-Grafenau hat sich im Laufe der vergangenen Jahre zu einer Technologieregion entwickelt. Demzufolge ist es von entscheidender Bedeutung, den regionalen Unternehmen gut ausgebildetes Fachpersonal zur Verfügung zu stellen.“
Regionalmanager Gruber informierte über die Demografische Entwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen für die Region und insbesondere auch für die hiesigen Bildungseinrichtungen. „Es ist eine gemeinsame Aufgabe, die Unternehmen der Region auf der Suche nach qualifizierten Arbeitnehmern zu unterstützen. Dies kann nur durch eine enge Partnerschaft von Bildung und Wirtschaft erfolgreich umgesetzt werden.“ Des Weiteren betonte Gruber die Bedeutung der Lehrkräfte für den Landkreis: „Gerade Lehrer sind wichtige Botschafter und Multiplikatoren für die Region.“
Als Vertreter des Technologie Campus Freyung referierte der Projektkoordinator Karl Kreuß vor dem Lehrerkollegium. Kreuß erläuterte die beruflichen Perspektiven für Absolventen in der Region. Gerade für Studierende der Fachrichtungen Informatik, Elektrotechnik oder Mechatronik bestünden sehr gute berufliche Perspektiven in der Region. Auch die Hochschule Deggendorf bietet Duale Studiengänge an und ist für Kooperationen mit regionalen Firmen offen. Außerdem erörterte er die akademischen Bedarfsprofile sowie die angebotenen Studiengänge der HDU Deggendorf.
Johann Ederer, Leiter Personal bei der Parat Beteiligungs-GmbH, stellte die Historie sowie die Unternehmensstruktur des Unternehmens dar und betonte, wie wichtig auch für dieses Unternehmen hochqualifiziertes Fachpersonal ist. Des Weiteren erläuterte Ederer, wie sich die Arbeits- und Berufswelt in der jüngsten Vergangenheit wandelte. „Gerade die Globalisierung erfordert ein hohes Maß an Flexibilität sowie ausgeprägte Fremdsprachenkenntnisse der Führungskräfte.“ Roland Biebl, Leiter Berufsausbildung der ZF Friedrichshafen AG am Standort Passau, ging auf das Thema „Duales Studium“ ein: „Ein Duales Studium ist sowohl für das Unternehmen als auch für den Studenten eine absolute Winwin-Situation. Der Student profitiert von der erhöhten Praxiserfahrung und das Unternehmen sichert sich betriebsintern Nachwuchskräfte.“ Biebl, der auch Elternbeiratsvorsitzender am JGG ist, erläuterte anhand eines konkreten Beispiels, wie ein dualer Studiengang aufgebaut ist, welche Schwerpunkte zu belegen sind und welche Abschlüsse ein Absolvent schließlich erreicht. Zusammenfassend stellte Biebl fest, „dass sich dieses System bewährt hat und wir sehr gute Erfahrungen mit dualen Studenten machen.“
Zum Abschluss übergab OStDin Stamm den neu gestalteten Flyer an die Referenten. Darin präsentiert sich das Johannes-Gutenberg-Gymnasium als moderne, innovative und weltoffene Schule, die nicht nur Lern- sondern auch Lebensraum für junge Menschen ist. OStDin Stamm bedankte sich bei den anwesenden Referenten für ihr Kommen und ihre Ausführungen und betonte die große Bedeutung dieses Aktionstages „für eine nachhaltige Vernetzung von Schule und Wirtschaft“. - pnp
Quelle: Passauer Neue Presse, 20. März 2013

Am Technologie Campus arbeiten angehende Naturwissenschaftler und Ingenieure zusammen
Freyung. Die „Sommerakademie Bionik“ fand dieses Jahr zum zweiten Mal am Technologie Campus Freyung statt. Sie ist ein Angebot der Hochschule Deggendorf und ermöglicht Studierenden verschiedener Fachdisziplinen die Bionik kennenzulernen.
„Die Bionik ist eine Querschnittsdisziplin, die zum einen als Wissenschaft in der Forschung zur Anwendung kommt. Sie ist darüber hinaus aber auch ein wichtiges Element der Produktentwicklung und kann Teil der Innovationsstrategie von Unternehmen sein. Ihr breites Anwendungsspektrum und ihr enormes Potenzial sind häufig noch unbekannt, daher möchten wir früh in der Bildung ansetzen und insbesondere auch Studierende mit der Arbeits- und Denkweise Bionik vertraut machen“, fasst Kristina Wanieck, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Bionik, die Intention der Sommerakademie zusammen.So kommen einmal pro Jahr Studierende aus ganz Deutschland nach Freyung, um mehr über Bionik zu erfahren und in Gruppen verschiedene Aufgaben zu lösen. Bei einem öffentlichen Kurzvortrag präsentieren die Teilnehmer ihre Ergebnisse einem breiten Publikum, was stets zu großer Begeisterung bei den Zuhörern führt, da die Teilnehmer in kurzer Zeit viele innovative Ideen entwickelt haben. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat, welches sie in ihrem eigenen Studium anrechnen können, und sie haben gelernt, die Bionik ergänzend zu ihrem Fachwissen einzusetzen.
Durchgeführt wird die Sommerakademie in Kooperation mit dem Verein „Knospe e.V.“, welcher es sich zum Ziel gesetzt hat, im Bayerischen Wald Angebote zu schaffen, die die Region für junge Menschen wieder attraktiver macht. Außerdem unterstützen ansässige Firmen die Sommerakademie als Sponsoren und ermöglichen dadurch die Qualifizierung junger Menschen in der Region, was den ein oder anderen vielleicht hierher zurückbringt. - pnp
Quelle: Passauer Neue Presse, 19. März 2013
Neues aus unseren Projekten:
Im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, soll in Zusammenarbeit zwischen der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Technischen Hochschule Deggendorf, das Thema 5G dem Handwerk und Mittelstand nähergebracht werden. Hierzu erfolgt eine Reihe von Infotexten, die auf verschiedene Gesichtspunkte von 5G eingehen.
Die fortschreitende Entwicklung drahtloser Netzwerktechnologien hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erlebt und verspricht, verschiedene Industriebereiche zu revolutionieren, insbesondere in Bezug auf die nahtlose Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Im Fokus dieses Textes steht die Fernsteuerung eines Universal Robot UR5 über ein 5G-Netzwerk und die damit verbundenen Auswirkungen der Reaktionszeit für einen Benutzer.
Die Integration von 5G in die Steuerung von Industrierobotern eröffnet neue Horizonte für Effizienz und Flexibilität in der Fertigungs- und Automatisierungsindustrie. Durch die Darstellung verschiedener Latenzszenarien konnten wir die direkten Auswirkungen auf die Robotersteuerung analysieren und wertvolle Einblicke gewinnen.
Dieser Infotext beleuchtet nicht nur die technischen Aspekte dieses Experiments, sondern betont auch die essenzielle Rolle einer zuverlässigen und reaktionsschnellen Netzwerkinfrastruktur für die erfolgreiche Fernsteuerung von Robotern. Vornehmlich wird auf die Bedeutung der Latenz als entscheidender Faktor hingewiesen und Empfehlungen für Unternehmen gegeben, die solche Systeme implementieren möchten.
Die Fernsteuerung von Robotern durch drahtlose Netzwerke hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Diese Technologie hat das Potenzial, viele Industriebereiche zu revolutionieren, insbesondere wenn es um die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine geht.
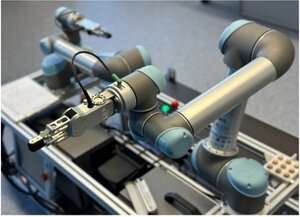

Für dieses Experiment wurde der Universal Robot UR5 aus Abbildung 1 verwendet, welcher für kollaborative Anwendungen ausgelegt ist. Die Steuerungseinheit besteht aus einem leistungsstarken Lenovo PC mit einem Intel Core i7 Prozessor. Die Verbindung zum Netzwerk erfolgt über einen 5G-Router, der eine drahtlose 5G-Verbindung bereitstellt. Die Hauptaufgabe bestand darin, eine Fernsteuerungsumgebung einzurichten, bei der ein Computer mittels einer Anwendung über das 5G-Netz Steuerbefehle an den Roboterarm übermitteln kann. So kann ein Benutzer standortunabhängig den Roboter über das 5G Netz ansteuern. Zu diesem Zweck wurde, wie in Abbildung 2 ersichtlich, zusätzlich eine Kamera vor dem Roboter als optische Hilfestellung für den Benutzer installiert. Zudem wurde eine in Python programmierte Steuerungssoftware verwendet, die es ermöglicht, den Roboter mit einem einfachen Gamepad zu steuern.
Experimente zeigten, dass die Latenz über das Netzwerk einen signifikanten Einfluss auf die Reaktionszeit des Benutzers und damit auf die Steuerung des Roboters hat. In Szenarien mit geringer Latenz, wie bei der Verwendung eines kabelgebundenen Netzwerkes oder eben eines 5G-Netzes, reagiert der Roboter schnell und präzise auf die Eingaben eines Benutzers. In Situationen mit höherer Latenz, wie bei der drahtlosen WLAN-Verbindung im realen Umfeld, ist eine Verzögerung in der Steuerung deutlich spürbar, was zu einer weniger präzisen Steuerbarkeit des Roboters führt. Dies gilt insbesondere für stark ausgelastete und von außen gestörte WLAN-Verbindungen
Die Ergebnisse der Tests verdeutlichen die Bedeutung einer zuverlässigen und reaktionsschnellen Netzwerkinfrastruktur für die Fernsteuerung von Robotern. Während drahtlose Technologien wie WLAN und 5G hohe Flexibilität bieten, müssen jedoch die damit verbundenen Latenzzeiten berücksichtigt werden, insbesondere in Anwendungen, die eine hohe Sicherheit sowie präzise Steuerung erfordern, wie eben bei kollaborativer Robotik. Unternehmen sollten bei der Implementierung solcher Systeme die Latenz als entscheidenden Faktor in Betracht ziehen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Die Fernsteuerung eines kollaborativen Roboters über ein 5G-Netzwerk stellt eine vielversprechende Technologie dar, die das Potenzial hat, die Effizienz und Flexibilität in verschiedenen Branchen zu verbessern. Durch Versuche mit unterschiedlichen Latenzen konnten wir die Auswirkungen auf die Steuerung des Roboters beobachten und wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Es ist wichtig, weiterhin in die Entwicklung und Optimierung von drahtlosen Netzwerken zu investieren, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit solcher Systeme zu maximieren und ihre breite Anwendung in der Industrie zu ermöglichen.

Im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, soll in Zusammenarbeit zwischen der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Technischen Hochschule Deggendorf, das Thema 5G dem Handwerk und Mittelstand näher gebracht werden. Hierzu erfolgt eine Reihe von Infotexten, die auf verschiedene Gesichtspunkte von 5G eingehen.
Die Einführung der 5G-Technologie hat die Tür zu einer Vielzahl aufregender Anwendungen geöffnet, darunter die Möglichkeit, Roboter nahezu überall für Ferninspektionen einzusetzen. Mit ihrer niedrigen Latenz und der hohen Bandbreite bietet 5G eine leistungsstarke Plattform für die Steuerung von Robotern sowohl im Freien als auch in Gebäudeinneren.
Diese fortschrittlichen Roboter können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, von der Inspektion von Außenanlagen wie Pipelines und Telekom-Infrastrukturen bis hin zur Erkundung von Innenräumen in Fabriken, Lagerhäusern und anderen Industrieanlagen. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht es, schwer zugängliche Bereiche zu erreichen und Inspektionen mit hoher Präzision durchzuführen, ohne dass menschliche Arbeitnehmer vor Ort sein müssen.
Dank der 5G-Konnektivität können diese Roboter mit geringer Latenz gesteuert werden, was eine sofortige Reaktion auf sich ändernde Situationen ermöglicht. Ferner ermöglicht die hohe Bandbreite von 5G die Übertragung hochauflösender Video- und Bildmaterialien, die für eine genaue Inspektion erforderlich sind, sowohl in Innen- als auch Außenbereichen.
Die Kombination aus fortschrittlicher Robotertechnologie und 5G-Netzwerken eröffnet neue Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen in verschiedenen Branchen. Von großen Industriebetrieben bis hin zum einfachen Handwerk bieten diese ferngesteuerten Inspektionsroboter eine innovative Lösung für die Herausforderungen der modernen Welt.
Um diesen Anwendungsfall näher zu beschreiben, wurde ein fernsteuerbarer Inspektionsroboter im Rahmen des Projektes entwickeln, welcher über ein 5G-Netzwerk kontrolliert wird. Der Roboter ist mit einer Kamera ausgestattet, um die Echtzeitübertragung von Bildern vom Roboter zum Benutzer zu ermöglichen.

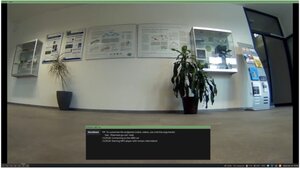
Bei der Auswahl der Hardware und Software wurden sowohl ein erschwinglicher Preis als auch die Anpassbarkeit berücksichtigt. Als Basis für den Roboter wurde die Plattform des Freenove 4WD Smart Cars verwendet [1].
Das 4WD Smart Car Kit von Freenove wurde aufgrund seiner Nutzung offener Technologien und seines niedrigen Preises als Plattform für dieses Projekt gewählt. Das Kit enthält alle notwendigen Teile für den Bau eines kleinen Roboter-Fahrzeuges. Zusätzlich wurde der Roboter mit einem Raspberry Pi-Computer ausgestattet, um die Steuerungsbefehle über das Netzwerk zu empfangen und an die Motoren weiterzuleiten. Für die Videoaufnahme wurde ein passendes Raspberry Pi Kameramodul verwendet, das Full-HD-Videos mit 50 FPS aufnehmen kann und mit einer Weitwinkel-Linse ausgestattet ist. Zudem kann für diese Kamera die hardwareseitig beschleunigte Video-Encodierung des Raspberry Pi genutzt werden. Die Verbindung zum 5G-Netzwerk erfolgt über das angeschlossene 5G-Modem Quectel RM500QGL. Welches auch für die Verbindung zu privaten 5G Campusnetzen genutzt werden kann.
Für die Inbetriebnahme des Roboters wurde das verbundene 5G-Modem mit einer aktiven SIM-Karte ausgestattet. Nach dem Start des Roboters erfolgt automatisch die Initialisierung einer Serversoftware für die Steuerung des Roboters und zur Videoübertragung. Die Client-Anwendung, welche auf einem beliebigen Computer ausgeführt werden kann, verbindet sich mit dem Roboter, indem sie die IP-Adresse des Roboters verwendet. Nach dem Start der Anwendung wird ein Fenster mit der Echtzeitvideoübertragung angezeigt, und der Benutzer kann den Roboter mithilfe des Gamepads steuern.
Dies dient als einfache Darstellung einer 5G gestützten Anwendung die sowohl am Technologie Campus in Freyung als auch am CMT der Handwerkskammer Niederbayern Oberpfalz besichtigt werden kann.

Im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, soll in Zusammenarbeit zwischen der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Technischen Hochschule Deggendorf, das Thema 5G dem Handwerk und Mittelstand näher gebracht werden. Hierzu erfolgt eine Reihe von Infotexten, die auf verschiedene Gesichtspunkte von 5G eingehen.
In der heutigen digitalen Wirtschaft spielen Datenübertragungsgeschwindigkeit und -zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Eine der wichtigsten Faktoren ist die Latenz, die die Verzögerung zwischen dem Senden eines Datenpakets und dem Empfangen einer Antwort definiert. Eine niedrige Latenz ist für KMU von entscheidender Bedeutung, da sie die Reaktionsfähigkeit, Effizienz und Leistungsfähigkeit ihrer Geschäftsabläufe verbessert.
In vielen Anwendungsbereichen sind niedrige Latenzzeiten unerlässlich. Im Einzelhandel ermöglichen sie etwa eine schnellere Abwicklung von Transaktionen an der Kasse und ein reibungsloses Funktionieren von Point-of-Sale-Systemen. In der Fertigung ermöglicht eine geringe Latenzzeit eine präzise Steuerung von Maschinen und Robotern, was die Produktivität steigert und die Ausfallzeiten minimieren kann. Im Gesundheitswesen können niedrige Latenzzeiten die Übertragung von medizinischen Daten in Echtzeit unterstützen, was für die Diagnose und Behandlung von Patienten entscheidend sein kann.
5G bietet gegenüber früheren Mobilfunktechnologien erhebliche Vorteile in Bezug auf die Latenz. Mit Latenzzeiten von wenigen Millisekunden ermöglicht 5G eine nahezu sofortige Datenübertragung, die den hohen Anforderungen von KMU in verschiedenen Branchen gerecht wird. Dies bedeutet, dass Unternehmen zeitkritische Applikationen auf mobilen Geräten umsetzen können, Echtzeitdaten in ihren Betriebsabläufen nutzen und innovative Anwendungen wie Augmented Reality und virtuelle Realität implementieren können.
Ein weiterer Vorteil von 5G in Bezug auf die Latenz ist die Fähigkeit, eine große Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen stabil zu unterstützen. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die eine Vielzahl von IoT-Geräten einsetzen, um Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Mit 5G können KMU ein dichtes Netzwerk von vernetzten Geräten aufbauen und dabei eine niedrige Latenz beibehalten, was die Effizienz und Leistung ihrer Betriebsabläufe weiter verbessert.
Insgesamt ist eine niedrige Latenz bei der Datenübertragung für KMU von entscheidender Bedeutung, da sie die Grundlage für eine schnellere, zuverlässigere und effizientere Vernetzung bildet. Durch die Einführung von 5G können Unternehmen von verbesserten Latenzzeiten profitieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalisierten Welt stärken.
Zur klareren Einordnung von Latenzzeiten können folgende Annahmen getroffen werden. Für eine einfache zuverlässige Datenübertragung reichen Latenzzeiten von weniger als 1 Sekunde. Eine vernünftige Telefonieverbindung benötigt Latenzzeiten von kleiner 300 Millisekunden. Zur responsiven Fernsteuerung von Maschinen oder Computern (z.B. über TeamViewer) werden Latenzzeiten bis maximal 100 Millisekunden angesetzt. Für eine Quasi-Echtzeitübertragung von Daten, welche auch für eine Fahrzeug zu Fahrzeug Kommunikation notwendig sein kann, spricht man von Latenzen im einstelligen Millisekundenbereich. Hierfür muss jede Komponente im Netzwerk auf kurze Latenzen optimiert sein.
 Um ein besseres Verständnis über die Bedeutung von Latenz zu vermitteln, wurde ein Latenz-Demonstrator im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“ aufgebaut. Das Ziel ist es, die Auswirkungen verschiedener Kommunikationstechnologien in Bezug auf die Reaktionszeit, greifbar darzustellen. Hierzu wurde eine Simulation in Form eines Computerspiels programmiert, bei der die Reaktionszeit der Bewegungseingabe, entsprechend den simulierten Latenzwerten bei einer Datenübertragung, dynamisch angepasst werden. Als Latenz wird in diesem Fall die Zeit von einem gesendeten Datenpaket bis zum Empfang der Eingangsbestätigung beschrieben, auch bekannt als Round Trip Time (RTT).
Um ein besseres Verständnis über die Bedeutung von Latenz zu vermitteln, wurde ein Latenz-Demonstrator im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“ aufgebaut. Das Ziel ist es, die Auswirkungen verschiedener Kommunikationstechnologien in Bezug auf die Reaktionszeit, greifbar darzustellen. Hierzu wurde eine Simulation in Form eines Computerspiels programmiert, bei der die Reaktionszeit der Bewegungseingabe, entsprechend den simulierten Latenzwerten bei einer Datenübertragung, dynamisch angepasst werden. Als Latenz wird in diesem Fall die Zeit von einem gesendeten Datenpaket bis zum Empfang der Eingangsbestätigung beschrieben, auch bekannt als Round Trip Time (RTT).
Das Ziel der Anwendung liegt beim Sammeln von Münzen unter verschiedenen Latenz-Bedingungen, die durch simulierte Joystick-Eingabeverzögerungen dargestellt werden. Jede Technologie - sei es WLAN, LAN, 4G oder 5G - beeinflusst die Steuerung des Avatars auf unterschiedliche Weise. Die simulierten Latenzen können auch angezeigt werden, um ein tieferes Verständnis über ihren Einfluss auf reale Applikationen zu erlangen.
Zur Umsetzung wurde ein Mini PC mit Touch Bildschirm verwendet, der die - mithilfe der open source Software Godot-Engine programmierte - Simulation ausführt. Diese Kombination ermöglicht es, eine realistische Simulation zu erstellen, um die Auswirkungen der verschiedenen Latenz-Bedingungen eindrucksvoll zu erleben. Während in der Simulation unter der Verwendung des Joysticks versucht wird Münzen zu sammeln, werden die Latenzen in WLAN-, LAN-, 4G- und 5G Umgebungen simuliert und die Reaktionszeit der jeweils gewählten Verbindung auch bildlich dargestellt. Durch diese Variationen der Latenz-Bedingungen können Unterschiede in der Responsivität der Steuerung live festgestellt werden.
Dieser experimentelle Ansatz zeigt, dass jede Technologie ihre eigenen Vor- und Nachteile hat. So kann WLAN anfällig für Störungen sein, während LAN eine stabilere Verbindung bietet. Obwohl 4G und 5G eine höhere Mobilität ermöglichen, weisen sie im Vergleich zu kabelgebundenen Verbindungen eine höhere Latenz auf. Im Demonstrator werden hierfür WLAN-Latenzen von wenigen Millisekunden bis zu einer Sekunde dargestellt, 4G bis 500 Millisekunden, 5G Latenzen mit bis zu 50 Millisekunden und kabelgebundene LAN Latenzen bis maximal 3 Millisekunden.
Die Latenz spielt dabei eine entscheidende Rolle bei der Fernsteuerung über drahtlose Netzwerke, daher ist ein gründliches Verständnis dieser unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit solcher Systeme zu verbessern. Dieser Simulator dient der Optimierung dieser Technologien und soll ihre Verbreitung im Handwerk und Mittelstand fördern.

Im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, soll in Zusammenarbeit zwischen der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Technischen Hochschule Deggendorf, das Thema 5G dem Handwerk und Mittelstand näher gebracht werden. Hierzu erfolgt eine Reihe von Infotexten, die auf verschiedene Gesichtspunkte von 5G eingehen.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie das Handwerk können erhebliche Vorteile aus der Nutzung von 5G-Testbeds oder offenen 5G-Testplätzen ziehen, insbesondere im Hinblick auf Produktbewertung, Evaluierung der Anschaffung eines eigenen privaten 5G-Campusnetzes und Applikationstests für neue Anwendungen.
5G-Testbeds bieten KMU die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen unter realistischen Bedingungen zu evaluieren. Durch die Nutzung eines 5G-Testnetzes können Unternehmen die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte in einer 5G-Umgebung testen und potenzielle Probleme oder Engpässe identifizieren, bevor sie in den regulären Betrieb gehen. Dies ermöglicht es KMU, fundierte Entscheidungen über die Weiterentwicklung und Optimierung ihrer Produkte zu treffen, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen.
Viele Betriebe erwägen möglicherweise die Einrichtung eines eigenen privaten 5G-Campusnetzes, um ihre internen Kommunikations- und Betriebsabläufe zu verbessern. Durch die Nutzung von 5G-Testplätzen können sie die Machbarkeit eines solchen Projektes evaluieren und die Leistungsfähigkeit eines privaten 5G-Netzes unter realen Bedingungen testen. Dies umfasst die Bewertung der Netzabdeckung, der Datenübertragungsraten, der Latenzzeiten und anderer Leistungsindikatoren, um sicherzustellen, dass ein privates 5G-Netz den spezifischen Anforderungen des Unternehmens entspricht.
Unternehmen, die neue Anwendungen oder Dienste entwickeln, können von 5G-Testbetrieben profitieren, um die Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Anwendungen in einer 5G-Umgebung zu testen. Dies umfasst die Durchführung von Lasttests, um die Skalierbarkeit der Anwendung zu überprüfen, sowie die Bewertung der Reaktionszeiten und der Benutzererfahrung unter realen Bedingungen. Durch die Nutzung von 5G-Testplätzen können Betriebe sicherstellen, dass ihre Anwendungen optimal auf die Anforderungen von 5G-Netzwerken abgestimmt sind und eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit bieten.
Insgesamt bieten 5G-Testbetriebe und offene 5G-Testplätze KMU die Möglichkeit, die Vorteile von 5G-Technologie zu nutzen und innovative Lösungen zu entwickeln, die ihren Geschäftsanforderungen entsprechen. Durch die Evaluation von Produkten, die Prüfung der Anschaffung eines eigenen privaten 5G-Campusnetzes und Applikationstests für neue Anwendungen können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und neue Chancen für Wachstum und Innovation erschließen.
Im Rahmen des Projektes 5G für Handwerk und Mittelstand stehen zwei Testbeds für Unternehmen und Handwerk für Testzwecke zur Verfügung, zum einen am CMT Charlottenhof der Handwerkskammer Niederbayern Oberpfalz und am Technologie Campus Freyung der technischen Hochschule Deggendorf. Beide Testbeds sind ausgebaute 5G Campus-Netze, die mit Frequenzen im Bereich 3700 MHz – 3800 MHz operieren. Die Netze sind mit jeweils unterschiedlicher Hardware aufgebaut worden und können somit ein breiteres Feld an Testmöglichkeiten abbilden. Im Folgenden wird das Testbed am TC Freyung genauer beleuchtet.
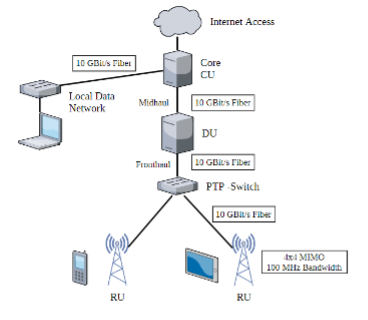 Das 5G Standalone Testbed am TC Freyung wurde mit dem Ziel entwickelt, eine Plattform für die Entwicklung und Demonstration maßgeschneiderter 5G-Anwendungen bereitzustellen, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerksbetrieben und KMUs zugeschnitten sind. Die Architektur des Testbeds basiert auf dem Open-RAN Standard, der eine flexible Integration verschiedener handelsüblicher Hardwarekom-ponenten ermöglicht. Diese Flexibilität ist entscheidend, um eine Vielzahl von Anwendungs-fällen abzudecken und individuelle Anpassungen auch nachträglich vornehmen zu können. Ebenso wird das Testbett durch eine Reihe von Demonstratoren ergänzt, die die praktische Anwendung von 5G in verschiedenen Szenarien verdeutlichen, darunter die Echtzeitsteuerung von Robotern, die Schulung von Mitarbeitern über Virtual Reality und die Fernwartung von Maschinen.
Das 5G Standalone Testbed am TC Freyung wurde mit dem Ziel entwickelt, eine Plattform für die Entwicklung und Demonstration maßgeschneiderter 5G-Anwendungen bereitzustellen, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerksbetrieben und KMUs zugeschnitten sind. Die Architektur des Testbeds basiert auf dem Open-RAN Standard, der eine flexible Integration verschiedener handelsüblicher Hardwarekom-ponenten ermöglicht. Diese Flexibilität ist entscheidend, um eine Vielzahl von Anwendungs-fällen abzudecken und individuelle Anpassungen auch nachträglich vornehmen zu können. Ebenso wird das Testbett durch eine Reihe von Demonstratoren ergänzt, die die praktische Anwendung von 5G in verschiedenen Szenarien verdeutlichen, darunter die Echtzeitsteuerung von Robotern, die Schulung von Mitarbeitern über Virtual Reality und die Fernwartung von Maschinen.
Das Testbed verfügt über eine Reihe von erweiterten Funktionen und Messgeräten, die eine umfassende Analyse und Optimierung von 5G-Anwendungen ermöglichen. Die Demonstratoren dienen nicht nur dazu, das Potenzial von 5G aufzuzeigen, sondern auch dazu, konkrete Lösungen für die Herausforderungen von Handwerksbetrieben und KMUs zu entwickeln. Durch die Integration von 5G in betriebliche Abläufe können Unternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Das 5G Standalone Testbed für Handwerksbetriebe und KMUs bietet eine einzigartige Gelegenheit, die digitale Transformation in kleinen und mittleren Unternehmen voranzutreiben. Durch die Bereitstellung praktischer Erfahrungen und sinnvoller Anwendungen wird die Einführung von 5G erleichtert und beschleunigt. Das Projekt strebt an, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Industrie und KMUs zu fördern und die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft zu stärken. Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Testbeds und die mögliche Integration neuer Technologien wie Netzwerkslicing und mmWave-Technologie werden dazu beitragen, das Unternehmen auch in Zukunft qualifizierte Entscheidungen über künftige Investitionen im Bereich 5G treffen können.

Im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, soll in Zusammenarbeit zwischen der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Technischen Hochschule Deggendorf, das Thema 5G dem Handwerk und Mittelstand näher gebracht werden. Hierzu erfolgt eine Reihe von Infotexten, die auf verschiedene Gesichtspunkte von 5G eingehen.
In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der die Vernetzung von Unternehmen eine entscheidende Rolle für ihren Erfolg spielt, wird die Einführung von 5G Campusnetzen zu einem wichtigen Schritt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese innovative Technologie bietet eine Reihe von Vorteilen und Möglichkeiten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.
Ein 5G Campusnetz ist im Wesentlichen ein privates 5G-Netzwerk, das speziell für die Anforderungen eines bestimmten Unternehmens oder einer Organisation konfiguriert ist. Im Gegensatz zu öffentlichen Mobilfunknetzen bietet ein Campusnetz eine maßgeschneiderte Lösung mit höherer Bandbreite, geringerer Latenzzeit und verbesserter Sicherheit. Dies macht es ideal für Unternehmen, die eine zuverlässige und leistungsstarke drahtlose Konnektivität benötigen, um ihre Betriebsabläufe zu unterstützen.
Ein zentraler Einsatzbereich für 5G Campusnetze in KMU liegt in der Verbesserung der internen Kommunikation und Zusammenarbeit. Durch die Bereitstellung schneller und zuverlässiger drahtloser Verbindungen können Mitarbeiter nahtlos auf Unternehmensanwendungen und -ressourcen zugreifen, unabhängig davon, wo sie sich auf dem Firmengelände befinden. Dies fördert die Effizienz und Produktivität, da Mitarbeiter flexibler arbeiten können und weniger Zeit mit der Bewältigung von Konnektivitätsproblemen verschwenden.
Darüber hinaus ermöglicht ein 5G Campusnetz die Implementierung fortschrittlicher Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT) und der künstlichen Intelligenz (KI). Durch die einfache Vernetzung von Geräten und Sensoren können Unternehmen nahezu in Echtzeitdaten erfassen und analysieren, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und ihre Prozesse zu optimieren. Zum Beispiel können Fertigungsunternehmen mithilfe von IoT-Sensoren die Maschinenleistung überwachen und vorbeugende Wartung durchführen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern. Und das eben auch mobil ohne Kabelanbindung.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Durch die Implementierung von 5G Campusnetzen können KMU innovative Dienstleistungen und Lösungen entwickeln, die auf den Bedürfnissen ihrer Kunden basieren. Beispielsweise können Einzelhändler standortbezogene Angebote und personalisierte Einkaufserlebnisse durch die Nutzung von 5G-Technologie bereitstellen, um die Kundenbindung zu stärken und neue Umsatzquellen zu erschließen.
Um 5G Sendefrequenzen für ein Campusnetzwerk von der Bundesnetzagentur zu erwerben, muss ein Unternehmen verschiedene Schritte unternehmen und bestimmte Anforderungen erfüllen. Zunächst sollte das Unternehmen eine gründliche Analyse durchführen, um die Bedürfnisse und Möglichkeiten des geplanten Campusnetzwerks zu verstehen. Dazu gehören die Identifizierung potenzieller Standorte, die Analyse der bestehenden Infrastruktur und die Bewertung des allgemeinen Nutzens
Beantragt können Frequenzen im Band N78 von 3700 MHz – 3800 MHz in 10 MHz Blöcken bis maximal 100 MHz. Das ist mehr als die öffentlichen Provider im gleichen Band nutzen können. Zur Beantragung sind zudem folgende Unterlagen bereitzustellen:
Ein Frequenznutzungskonzept, welches als Erklärung u.a. dafür dient, für welchen Zweck die beantragten Frequenzen benötigt werden. Zum Beispiel für den Aufbau eines störungsfreien Kommunikationssystems zur Übertragung von umfangreichen Messdaten innerhalb und außerhalb des Betriebsgebäudes.
Des Weiteren muss die geplante Versorgungsfläche in Form von GPS-Koordinaten angegeben werden, dies dient auch als Berechnungsgrundlage für die Lizenzgebühr. Diese wird aus einer Berechnungsformel ermittelt und beträgt mindestens 1000 €. Die Lizenz kann dabei für eine Dauer von maximal 10 Jahren beantragt werden.
Für den Antrag sind zudem noch die verwendeten Antennensysteme mit Übertragungseigenschaften sowie die Bestätigung des Grundstückseigentums bzw. Nutzungsrechte. Schließlich ist noch die eigene Fachkunde für einen ordnungsgemäßen Aufbau und Einsatz des 5G Systems zu bestätigen bzw. durch die Angabe eines hierfür beauftragten Unternehmens anzugeben.
Die Erstellung eines Antrags für die Nutzung von 5G Frequenzen mag auf den ersten Blick sehr umfänglich wirken, ist jedoch mit der Unterstützung des beauftragten Unternehmens zum 5G Campusnetzaufbau oder direkt durch die Bundesnetzagentur innerhalb von ein paar Wochen zu erledigen.
Insgesamt erfordert der Erwerb von 5G-Frequenzen für ein Campusnetzwerk bei der Bundesnetzagentur eine sorgfältige Planung, eine gründliche Vorbereitung und die Einhaltung gesetzlicher und technischer Anforderungen.

Im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, soll in Zusammenarbeit zwischen der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Technischen Hochschule Deggendorf, das Thema 5G dem Handwerk und Mittelstand näher gebracht werden. Hierzu erfolgt eine Reihe von Infotexten die auf verschiedene Gesichtspunkte von 5G eingehen.
WLAN (Wireless Local-Area Networks) auch Wi-Fi genannt, nach dem Firmenkonsortium Wi-Fi Alliance, ist der verbreitetste Standard für die Datenübertragung im unlizenzierten Frequenzbereich und wird nahezu in jedem Haushalt und jedem Unternehmen eingesetzt.
Wi-Fi 6 wird auch als die 6te Generation des WLAN Standards bezeichnet. Der WLAN Standard selbst lautet IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) und Wi-Fi 6 entspricht dem Standard IEEE 802.11ax. Die Namensgebung Wi-Fi 1 – 6 wurde erst 2020 eingeführt, um eine einfachere Einordnung der Standards zu ermöglich. Davor wurde entsprechend von IEEE 802.11 (b, a, g, n, ac, ax) gesprochen. Am relevantesten sind heute noch die folgenden Standards:
Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n), welcher meist noch bei günstigen Geräten im Frequenzbereich von 2,4 GHz verwendet wird und neben der gleichzeitigen Nutzung von mehreren Antennen mittels MIMO (Multiple Input Multiple Output) auch eine maximale Sendebandbreite von 40 MHz für eine maximale Bruttodatenrate von 150 Mbit/s je Antenne brachte.
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) machte den Frequenzbereich von 5 GHz in der Breite nutzbar und steigerte somit auch die maximale Frequenzbandbreite auf bis zu 160 MHz. Zusätzlich mit weiteren Verbesserungen wurden hierdurch eine Bruttodatenrate von bis zu 866 Mbit/s je Antenne möglich.
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) steigerte die Effizienz der Funkübertragung durch den Einsatz von OFDMA (orthogonal frequency-division multiple access) einer Technik wie sie auch im Mobilfunk eingesetzt wird. Dies verbessert insbesondere die Kommunikation im Netz mit mehreren WLAN-Endgeräten (Smartphones etc.). Durch OFDMA und weitere Verbesserungen konnte somit die erreichbare Bruttodatenrate bei identischer Frequenzauslastung von Wi-Fi 5 auf bis zu 1201 Mbit/s je Antenne gesteigert werden.
Wi-Fi 6E steht für die Erweiterung des nutzbaren Frequenzbandes von 5 GHz auf 6 GHz und ermöglicht so die Nutzung weiterer WLAN-Kanäle, wovon insbesondere große bzw. eng gedrängte WLAN Netze profitieren. Dies stellt eine grobe Übersicht über die Entwicklung des WiFi Standards dar und dient als Orientierungshilfe.
Wi-Fi bzw. WLAN-Netze lassen sich kostengünstig aufbauen und einfach in Betrieb nehmen. Bei optimalen Bedingungen lassen sich wie beschrieben auch sehr hohe Durchsatzraten erzielen, so sind theoretisch bei einer üblichen 2x2 MIMO-Verbindung mit zwei Antennen bis zu 2402 Mbit/s an Bruttodatenrate möglich. Die tatsächlichen übertragenen Nettodatenraten können jedoch stark davon abweichen. Unter realistischen Bedingungen mit Hindernissen zwischen Sender und Empfänger sowie kleineren Frequenzbandbreiten fällt die Nettodatenrate schnell auf ein Viertel und weniger des theoretischen Maximums ab. Kommen noch weitere Faktoren wie Interferenzen im unlizenzierten Frequenzband, eine hohe Netzauslastung sowie suboptimale Empfangsmodule dazu, so bleibt oft nur ein Bruchteil der Netzleistung je Teilnehmer übrig.
Eine weitere Eigenschaft von Wi-Fi sind die potenziell niedrigen Latzenzzeiten. So ist es mit Wi-Fi durchaus möglich Latenzzeiten von wenigen Millisekunden zu erreichen. Jedoch sind diese Werte nicht stabil und können durch Störungen schnell bis in den Sekundenbereich steigen. Auch ist die sichere Datenübertragung nicht gewährleistet und es können bei Interferenzen auch hohe Verlustraten auftreten. Daran zeigen sich am deutlichsten die Nachteile von Funktechnologien im unlizenzierten Frequenzbereich. Generell können bei Wi-Fi die freien Frequenzbänder eben nicht beliebig von allen Teilnehmern genutzt werden, ansonsten wäre ein normaler Betrieb bei mehr als einem Sendegerät nicht möglich. Daher gilt ein gewisses Fair-Use Prinzip, bei dem alle Geräte sich das verfügbare Spektrum teilen.
Dem gegenüber steht 5G, welches primär auf lizenzierte Frequenzräume setzt und daher bereits das Problem mit Interferenzen größtenteils gelöst ist. Da nur zugelassenen Betreiber die von der Bundesnetzagentur zugeteilten Frequenzen für 5G nutzen dürfen. Somit ist die Voraussetzung für ein möglichst stabiles Funknetzwerk gegeben und kann auch für kritischerer Anwendungen eingesetzt werden. Ein Nachteil der lizenzierten Frequenzen ist, dass in der Regel nur eine begrenzte Frequenzbandbreite zur Verfügung gestellt werden kann. Somit können in Deutschland nur maximal 100 MHz Bandbreite im Frequenzbereich < 6 GHz für Campusnetze beantragt werden, wohingegen bei Wi-Fi allein im 5 GHz Bereich zwei 160 MHz Blöcke nutzbar sind, jedoch von jedem gleichzeitig und nahezu überall. Es sei aber noch erwähnt, dass für 5G im mmWave Bereich (> 24 GHz) Frequenzbandbreiten bis zu 800 MHz bereitstehen.
Darüber hinaus ist 5G durch die technische Struktur aus dem klassischen Mobilfunk bereits bestens für die Verwaltung von hohen Teilnehmerzahlen gerüstet. Ein 5G Netz kann im Gegensatz zu Wi-Fi sehr gut in der Zahl der aktiven Nutzer skaliert werden. Bei Wi-Fi Netzen sollten jedoch nur max. 50 aktive Endgeräte von einem Wi-Fi Access Point gleichzeitig versorgt werden. Bei etwas höheren Anforderungen sinkt diese Empfehlung bereits auf 10 – 15 Wi-Fi Nutzergeräte. Wie aus dem Alltag bekannt können Mobilfunkstationen mit 4G/5G jedoch hunderte bis tausende Nutzer verwalten.
Ein klarer Nachteil bei 5G ist der aktuell hohe Preis, allein ein 5G Modem kostet noch mehrere Hundert Euro und ein eigenes 5G Campusnetz bewegt sich meist im 6-stelligen Bereich. Allerdings ist diese Hardware auch deutlich leistungsfähiger. So können 5G Modems auch bei sehr schlechten Empfangsbedingungen noch normal arbeiten bei denen Wi-Fi Geräte bereits keine Verbindung mehr aufbauen können. Zudem gibt es bei 5G zahlreiche nützliche Features, wie das im vorherigen Beitrag genannte Network-Slicing, welches den entkoppelten Betrieb von Endgeräten im gleichen Netzwerk mit angepassten Sendeeigenschaften erlaubt. Mit 5G ist es möglich hochspezialisierte Netze aufzubauen, die so mit den Werkzeugen aus dem IEEE 802.11 Standards für WLAN nicht möglich wären. Zudem können bei 5G mit der Nutzung von öffentlichen Providernetzen die Ortsabhängigkeiten von Netzen aufgelöst werden und ein vollständig mobiler Betrieb von Nutzergeräten ermöglichen. In öffentlichen Providernetzen stehen u.a. auch die Frequenzen 700 MHz, 1800 MHz und 2100 MHz zur Verfügung, wodurch eine nahezu flächendeckende Versorgung mit 5G möglich ist.
Abschließend lässt sich somit folgendes festhalten, Wi-Fi macht vor allem dort Sinn, wo eine kostengünstige Lösung gefordert ist und die Anforderungen an das Netz im überschaubaren Rahmen bleiben. Für neue Wi-Fi Projekte sollte darauf Wert gelegt werden den jeweils aktuellen Standard zu verwenden, da mit jeder Generation signifikante Fortschritte gemacht werden. Ein 5G Netz ist dann angebracht, wenn hohe Sicherheit, Stabilität und/oder Mobilität gefordert sind sowie Applikationen beim Nutzer existieren, die von 5G und seinen Features profitieren können oder sogar erst durch 5G möglich werden.

Im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, soll in Zusammenarbeit zwischen der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Technischen Hochschule Deggendorf, das Thema 5G dem Handwerk und Mittelstand näher gebracht werden. Hierzu erfolgt eine Reihe von Infotexten die auf verschieden Gesichtspunkte von 5G eingehen.
Durch 5G werden bestehende Anwendungen im Bereich Extended Reality (XR), welche zwar grundsätzlich auch mit 4G umsetzbar wären, alltagstauglich und für einen breiteren Einsatz interessant. Zum einen steigen nämlich die Leistungswerte bei 5G Netzen gegenüber 4G und zum anderen können 5G Netze mit Hilfe von Slices auf bestimmte Anwendungen getrimmt werden oder auch teilweise Kundenexklusiv bereitgestellt werden.
XR stellt hierbei einen Überbegriff dar, der alle bekannten Arten der digitalen Realitäten in sich vereint. Hierrunter fällt u.a. Augmented Reality (AR), welches zumeist bei Smartphones Einsatz findet und im Kamerabild des Gerätes weitere virtuelle Objekte einblenden kann. Somit lassen sich im Raum virtuell Möbel oder Geräte in Originalgröße platzieren und ermöglichen eine Abschätzung des passenden Stellplatzes. Virtual Reality (VR) wird zumeist im Zusammenhang mit Computerspielen genannt, da hierbei über eine VR-Brille eine rein virtuelle Darstellung dargeboten wird, mit der, aus der Ich-Perspektive, über passende Controller interagiert werden kann. Diese Technik wird aber auch genutzt, um Bauprojekte bereits in der Planungsphase zu begehen, oder auch um virtuell Schulungen an Anlagen und Maschinen durchzuführen. Zuletzt sei noch Mixed Reality (MR) erwähnt, welches über spezielle Hardware, wie die Hololens von Microsoft, es versteht virtuelle Objekte mit der echten Welt zu verschmelzen und somit u.a. für Einsätze im Bereich Remote-Assist prädestiniert ist. Hierdurch kann ein Helfer aus der Ferne einem Anwender punktgenau Anweisungen an einem echten Gerät vor Ort geben und gleichzeitig die richtige Bedienung begutachten. Abseits von den genannten Punkten gibt es auch Mischanwendungen, die z.B. Funktionen aus VR und AR vereinen, daher ist es oft am besten schlicht von XR-Anwendungen zu sprechen.
XR-Anwendungen benötigen nicht zwangsweise eine gute Drahtloskommunikationsverbindung, viele Anwendungen können auch rein lokal auf einem Gerät ablaufen und funktionieren selbständig. Interessant wird es, wenn es gilt auf einen großen Datenpool zuzugreifen und nur die benötigten Daten zu laden, zum Beispiel bei Bauplänen und Architekturprojekten. Diese sollen dann schnell und ohne große Verzögerung bereitstehen. Eine andere denkbare Anwendung ist die Fernsteuerung von Robotern über XR, hierbei sollen z.B. die Kamerainformationen und die Steuerbefehle mit möglichst kurzer Latenz übertragen werden, um eine möglichst verzögerungsfreie Bedienung zu ermöglichen. Hierbei ist auch eine robuste Datenübertragung ohne Störungen gewünscht, wodurch solche Anwendung zusätzlich von einem 5G Netz gegenüber WLAN profitieren können. Nicht zuletzt sei erwähnt, dass durch 5G der mobile Einsatz von XR im Feld attraktiver wird, z.B. für Remote Assist bei komplizierten Anlagen und auch für ortsunabhängige Schulungen mittels VR genutzt werden kann.
Abseits von XR werden durch 5G auch künftige Anwendungsfelder erschlossen, welche durch 4G und WLAN nicht abgedeckt werden können. So wird es mit mmWave 5G Systemen (Frequenzen größer 24 GHz) möglich, im Rahmen von Ultra Reliable Low Latency (URLLC), Echtzeitanwendungen mit benötigten Latenzen < 1ms drahtlos umzusetzen. Hierfür ist bis jetzt eine Kabelgebunde Kommunikationsleitung nötig gewesen. So können z.B. Hochgeschwindigkeitsanlagen in der Produktion modularer aufgebaut werden und schneller bei Bedarf umgesetzt werden. Des Weiteren können Industrieroboter mobil aufgebaut werden und sind zu jeder Zeit über 5G performant mit einem Datennetz verbunden. Durch URLLC könnten auch Sicherheitssysteme drahtlos umgesetzt werden, welche eine hohe Verbindungssicherheit benötigen.
Weiterführend können künftig angepasste 5G Systeme für Positionierungs- und Ortungsaufgaben, insbesondere im Innenbereich genutzt werden, um kontinuierliche Positionsinformationen zu erhalten, um somit ein detaillierteres Monitoring zu ermöglichen. Dies könnte zum Beispiel für Logistiksysteme genutzt werden.
Im Zuge der Weiterentwicklung von 5G in Form der einzelnen 3GPP Releases werden immer mehr Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten ergänzt, welche bereits bis zu Orbitalanwendungen im Satellitenbereich reichen.

Im Rahmen des Projektes „5G für Handwerk und Mittelstand“, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, soll in Zusammenarbeit zwischen der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und der Technischen Hochschule Deggendorf, das Thema 5G dem Handwerk und Mittelstand näher gebracht werden. Hierzu erfolgt eine Reihe von Infotexten, die auf verschieden Gesichtspunkte von 5G eingehen.
Bei 5G handelt es sich nicht nur um die logische Weiterentwicklung des Mobilfunkstandard 4G (LTE) für große Provider, sondern um eine offene flexible Technologie, welche unter anderem im Rahmen von Campusnetzen, von allen eingesetzt werden kann. Daher steht 5G neben höhere Durchsatzraten, kürzeren Latenzzeiten und verbesserte Teilnehmerdichte, vor allem auch für flexible zugeschnittene Netze, die entsprechend den eigenen Anforderungen aufgebaut werden können. So ist es zum Beispiel möglich, neben dem öffentlichen Netz auch hybride Lösungen zu nutzen. Gemeint ist damit eine priorisierte teilexklusive Verwendung des öffentlichen Netzes in Form eines eigenen Slices. Darüber hinaus könnte sogar eine eigene Funkzelle eines Providers auf dem eigenen Betriebsgelände aufgebaut werden. Die Möglichkeiten ziehen sich hierbei bis hin zu einem komplett autark betriebenen 5G Campusnetz, welches ausschließlich für interne Zwecke zur Verfügung steht.
Neben den architektonischen Möglichkeiten für den Netzaufbau, kann ein 5G Netz wie erwähnt den jeweiligen Anforderungen angepasst werden. So dreht sich das Mobilfunknetz der 5ten Generation nicht nur um Smartphones, Tablets oder intelligente Lautsprecher, sondern erobert neue Anwendungsgebiete im Bereich Echtzeitkommunikation oder massive IoT. In Zukunft sollen Latenzzeiten von weniger als einer Millisekunde möglich sein. Das liegt dann auf dem Niveau von kabelgebundenen Systemen und ermöglicht eine nahezu verzögerungsfreie Kommunikation.
Im Vergleich zu gängigen Funktechnologien wie WLAN fällt der Unterschied sogar noch drastischer aus. Denn durch die lizensierten 5G Frequenzräume wird eine Robustheit der drahtlosen Kommunikation erreicht, welche durch potenziell störanfällige, im unlizenzierten Funkbereich arbeitende Systeme (zum Beispiel Bluetooth), nicht darstellbar sind. Dies liegt schlicht daran, dass die hierfür eingesetzten Frequenzen von jedem verwendet werden dürfen. Man denke nur an einen privaten WLAN-Hotspot vom Smartphone eines Mitarbeiters in Reichweite des firmeninternen WLAN-Netzes.
Aufgrund der Vielzahl positiver Eigenschaften werden 5G Netze bereits in Industrie, Medizin, Logistik, Forschung und vielen weiteren Bereichen eingesetzt. So setzt zum Beispiel die Lufthansa 5G gestützte mobile Kamerasysteme für die Ferndiagnose von Triebwerken ein. Mit klassischen WLAN-Netzen wäre dies in der geforderten Qualität nicht machbar. Des Weiteren ergeben sich neue Möglichkeiten beim Aufbau von flexiblen Industriestraßen, dem Einsatz von XR-Remote Assist oder dem Aufbau einer autonomen Warenhalle.

Anfahrt

Technische Hochschule Deggendorf
Technologie Campus Freyung
Grafenauer Str. 22
D-94078 Freyung
+49 (0)8551 91764-0
+49 (0)8551 91764-69





















